Heiliger Kallistus I., Papst der Barmherzigkeit
Der heilige Kallistus I., manchmal auch Callistus geschrieben, bleibt eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 3. Jahrhunderts. Als freigelassener Sklave wurde er der 16. Bischof von Rom und von 217 bis 222 Papst. Er verkörperte eine mutige und zutiefst evangelische Pastoralvision, die auf Barmherzigkeit, Akzeptanz und Versöhnung basierte. Er war der Organisator der Katakomben, die seinen Namen tragen, und zugleich ein Pastor in der Krise, der mit den inneren Spannungen einer bereits vielfältigen Kirche und mit Lehrkontroversen, die die Orthodoxie prägten, zu kämpfen hatte. Sein Martyrium während eines Aufruhrs in Trastevere besiegelte ein Leben im Dienste Christi und seiner Kirche.
Essentielles Porträt
- Name: Calixtus (Callixtus, Callistus), Papst von 217 bis 222
- Kontext: Kirche von Rom zu Beginn des 3. Jahrhunderts, zeitweilige Verfolgungen, soziale und doktrinäre Veränderungen
- Wahrzeichen: Freigelassener Sklave, Diakon des Zephyrinus, Verwalter des Friedhofs der Via Appia (Katakomben von Saint-Calixte)
- Erbe: Barmherzige Bußdisziplin, Aufnahme von Sündern, Erleichterung des Eintritts in das Katechumenat, Erlaubnis zur Eheschließung zwischen Sklaven und freien Menschen
- Gedenktag: 14. Oktober, Martyrium in Rom, begraben auf dem Friedhof von Calepoda, Via Aurelia

Rom an der Wende zum 3. Jahrhundert
Das dritte Jahrhundert begann in einer unruhigen Welt. Das Römische Reich blieb mächtig, war aber geschwächt. Christen waren nun in den großen Städten, insbesondere in Rom, präsent. Ihr Wachstum warf Fragen auf: Wie konnte man Konvertiten unterschiedlicher Herkunft willkommen heißen? Wie konnte man angesichts konkurrierender Lehren Einheit leben? In diesem Kontext war der Bischof von Rom nicht nur ein geistlicher Führer; er musste Spannungen bewältigen, sein Volk schützen, den von den Aposteln empfangenen Glauben bewahren und das Gemeindeleben organisieren, einschließlich der Begräbnis- und Versammlungsstätten.
Ein christlicher Sklave im Kampf mit der Welt
Antike Quellen beschreiben einen schwierigen Start in sein Leben. Kallistus war ein christlicher Sklave, dem sein Herr die Leitung einer Bank anvertraut hatte. Das Unternehmen ging bankrott, und sein Ruf war so schlecht, dass er zur Arbeit in den Bergwerken Sardiniens verurteilt wurde – eine harte und oft tödliche Strafe. In dieser Dunkelheit tauchte ein unerwarteter Hoffnungsschimmer auf: Marcia, die Mätresse des christenfreundlichen Kaisers Commodus, setzte sich für einige der Verurteilten ein; Kallistus gehörte zu denen, die Begnadigung erreichten. Anschließend zog er sich vorübergehend aus Rom zurück und erfuhr die diskrete, aber konkrete Unterstützung von Papst Viktor, der ihm half, sich dem Studium der Heiligen Schrift zu widmen.
Diese Passage ist entscheidend. Kallistus ist nicht länger nur ein Überlebender; er wird zum Schüler des Wortes. Er lernt Geduld, wie man ein neues Alphabet lernt. Die Schwere seiner Erfahrung wird seine Theologie prägen: Barmherzigkeit ist kein schwaches Zugeständnis, sondern die Kraft des Evangeliums, die den Sünder aufrichtet.
Unter Zephyrin: der Archidiakon und der Organisator
Während des Pontifikats von Zephyrinus wurde Kallistus Archidiakon, also der wichtigste Mitarbeiter für die zentralen Missionen. Ihm wurde die Verantwortung für die Anlage eines Gemeindefriedhofs an der Via Appia übertragen. Diese Begräbnisstätte, heute als Kalixtus-Katakomben bekannt, entwickelte sich zu einem der heiligsten und symbolträchtigsten Orte des frühen Christentums. Mehrere Päpste des 3. Jahrhunderts, Märtyrer und zahllose Getaufte, deren Andenken eng mit dem der römisch-katholischen Kirche verbunden ist, wurden dort begraben.
Die Organisation eines Friedhofs war damals keine zweitrangige Aufgabe. Es ging darum, eine Gemeinschaft in ihrer Beziehung zu Tod und Hoffnung zu strukturieren. Die unterirdischen Galerien schützten die Überreste, vor allem aber das Versprechen: Christus ist auferstanden, und wer in ihm stirbt, wird auferstehen. Das Volk Gottes an einem einzigartigen, geordneten und dauerhaften Ort zu bestatten, bedeutete, ein Haus für den Glauben über Generationen hinweg zu errichten.

Zum Bischof von Rom gewählt: eine pastorale Vaterschaft
Im Jahr 217 wurde Kallistus zum Bischof von Rom gewählt. Sein Pontifikat war zwar kurz, aber äußerst fruchtbar, fiel jedoch in eine Zeit latenter Unruhen und Lehrdebatten. Jede Entscheidung zählt, denn sie berührt das Herz des christlichen Lebens.
Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen zwei Entscheidungen, die Anlass zu Debatten und manchmal auch zu Missverständnissen gaben:
- Er genehmigte entgegen dem Zivilrecht die Eheschließung zwischen Sklaven und freien Menschen. Symbolisch gesehen ist das eine Bombe. Kallistus behauptet, das Sakrament sei keinen sozialen Hierarchien unterworfen. Die christliche Ehe ist kein Klassenprivileg, sondern ein Bund vor Gott, der den Getauften angeboten wird.
- Er ließ jeden aufrichtig reuigen Sünder Buße empfangen, wie schwer seine Sünden auch sein mochten. Auch hier lehnte er es ab, die Kirche zu einer Gemeinschaft vollkommener Auserwählter zu machen. Die Kirche ist ein Krankenhaus, kein Museum. Wunden werden durch Gnade geheilt, und eine Rückkehr zur Gemeinschaft ist möglich.
Eine Kirche, viele Temperamente: Die Kontroverse mit Hippolyt
Die Figur des Hippolyt, Priester und Theologe, steht Kallistus gegenüber. Gelehrt, anspruchsvoll, auf die Reinheit der Lehre und Disziplin bedacht, reagiert Hippolyt auf Kallistus' pastorale Orientierungen, die er für zu nachsichtig hält. Die Meinungsverschiedenheit wird zum Bruch: Hippolyt führt eine Gruppe von Gläubigen in ein dauerhaftes Schisma und wird zum ersten bekannten Gegenpapst der Geschichte.
Das zugrunde liegende Problem ist zweifacher Natur:
- Auf doktrinärer Ebene erregten christologische Kontroversen um die Dreifaltigkeit und die Modalitäten der Vereinigung von Vater und Sohn die Gemüter. Kallistus wich entgegen den Anschuldigungen nicht vom apostolischen Glauben ab, weigerte sich jedoch, den allzu engen Auslegungen zu folgen, die die Tür zur Universalität der Erlösung verschlossen.
- Auf disziplinarischer Ebene geht es um die der Kirche anvertraute Autorität zum „Binden und Lösen“. Die damals geltende öffentliche Buße war strengen Regeln unterworfen. Kallistus hält an der Forderung der Bekehrung fest, lässt aber der Gnade Raum. Sein Kriterium ist nicht Schwäche, sondern der Realismus des Evangeliums, getragen vom Heiligen Geist.
Die Nachwelt hat eine differenzierte Entscheidung getroffen: Hippolyt selbst wird als Heiliger verehrt, ein Zeichen dafür, dass die Wahrheit auch diejenigen zusammenbringen kann, die die Geschichte getrennt hat. Das Werk des Kallistus hingegen wird als pastoral und im stärksten Sinne katholisch anerkannt: auf die gesamte Kirche ausgerichtet.
Bußdisziplin nach Kallistus
Sünder aufzunehmen bedeutet nicht, der Sünde auszuweichen. Kallistus fordert einen aufrichtigen Ansatz: Beichte, Umkehr, mögliche Wiedergutmachung und Wiedereinsetzung in den seligen Stand. Vergebung ist kein einfacher moralischer Freispruch; sie ist sakramental, kirchlich und realistisch. Sünde verletzt den ganzen Körper; Buße heilt den ganzen Körper, indem sie die Nächstenliebe wiederherstellt. In der Logik der Zeit spielt der Bischof eine entscheidende Rolle: Er wacht über die Disziplin, schlichtet schwierige Fälle und verkörpert die Vaterschaft Gottes.
Manche, wie Tertullian, der zum Rigoristen geworden war, verspotteten diese Barmherzigkeit als Schwäche. Doch Kallistus' Einsicht wurzelte in der Heiligen Schrift und der lebendigen Tradition: Gott liebt es zu vergeben, und die Kirche muss die Tür zur Umkehr öffnen. Heiligkeit ist nicht der Nicht-Sündenfall, sondern die Fähigkeit, in Christus wieder aufzuerstehen.
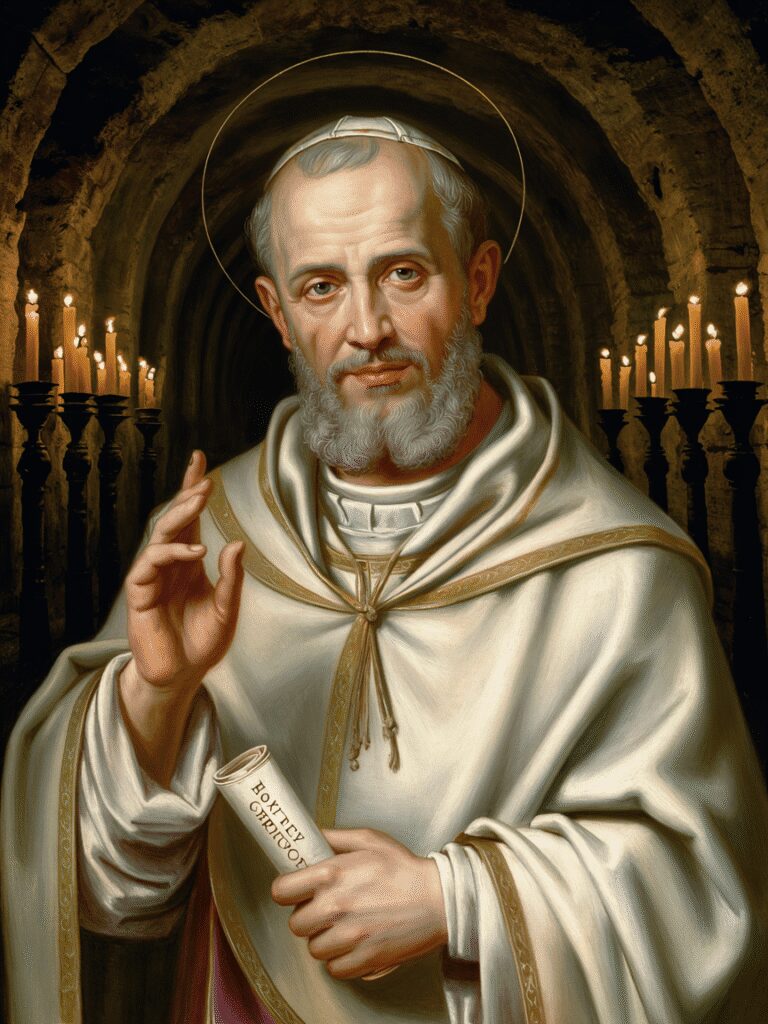
Das Katechumenat: eine offene Tür, aber nicht weit offen
Calixtus erleichtert den Zugang zum Katechumenat. Dabei geht es nicht darum, die Hürde zu senken, sondern die Vielfalt der Wege anzuerkennen. In Rom kommen Kandidaten aus allen Schichten und aus allen Gesellschaftsschichten. Die Prüfungszeit bleibt bestehen, die Ausbildung ist real, aber die Annahme des Ausschlusses hat keinen Platz. Indem Calixtus den Einstieg in den Prozess erleichtert, fördert er das Wachstum der Kirche, ohne auf Begleitung zu verzichten.
Ehe und evangelische Gerechtigkeit
Die Ehe zwischen Sklaven und freien Menschen zuzulassen, bedeutet, der Würde der Taufe Vorrang vor dem Zivilstand einzuräumen. Die Kirche schafft die Sklaverei nicht plötzlich ab, sondern bereitet ihren Untergang vor. Indem er erklärt, dass grundlegende Freiheit und Gleichheit vor Gott auf dem Spiel stehen, widerspricht Kallistus der Logik der Welt. Das Sakrament wird zum Ort, an dem sich die Gesellschaftsordnung der Gnade beugt.
Diese mutige Neuerung hat tiefgreifende Auswirkungen. Sie zwingt die Gemeinden, die Aufnahme von Paaren, die Registrierung von Kindern und die pastorale Kohärenz zu überdenken. Zeitgenössisch ausgedrückt könnte man sagen, dass Kallistus eine praktische Synodalität praktiziert: Er hört zu, erkennt und entscheidet zum Wohle des Einzelnen und für die Einheit.
Der Pfarrer der Katakomben
Die von Kallistus angelegten Katakomben der Via Appia bilden eine unterirdische Welt des Glaubens, der Kunst und der Erinnerung. Schlichte Fresken, Symbole (der Fisch, der Anker, der Gute Hirte), kurze Grabinschriften: Alles spricht von christlicher Hoffnung. Der Untergrund ist kein Versteck der Angst, sondern die Matrix einer Kultur. Die Kirche der Märtyrer ist nicht vom Tod fasziniert; sie erkennt in ihm den Übergang zum Leben.
Die Topographie dieses Friedhofs mit seinen Nischen, Galerien und Nischen spiegelt eine organisierte, vereinte Gemeinschaft wider, die sich ihrer Berufung bewusst war. Im 3. Jahrhundert wurden hier mehrere Päpste begraben, ein Zeichen der Autorität dieses Ortes. Paradoxerweise ruht Kallistus selbst nicht auf „seinem“ Friedhof, sondern auf dem Friedhof des Kalepodus an der Via Aureliana, wo er nach seinem gewaltsamen Tod seine letzte Ruhe fand.
Martyrium in Trastevere
Der Überlieferung zufolge starb Kallistus 222 bei einem Aufstand gegen Christen in Trastevere. Einige Berichte sprechen von einer brutalen Hinrichtung oder sogar davon, dass sein Leichnam in einen Brunnen geworfen wurde. Der springende Punkt ist jedoch ein anderer: Kallistus besiegelte mit seinem Blut die Lehre der Barmherzigkeit, die er gepredigt hatte. Er antwortete auf Gewalt nicht mit Gewalt, sondern mit Opfern.
Seine Beerdigung auf dem Friedhof von Calepoda ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Erinnerung. Die römische Liturgie begeht am 14. Oktober sein Gedenken. Die Tradition verbindet seinen Namen manchmal mit dem alten Titulus, der später zu Santa Maria in Trastevere wurde. Ob er nun deren Gründer oder Inspiration war, Trastevere trägt seinen Stempel.

Lehrmäßiges und pastorales Erbe
- Eine normative Barmherzigkeit: Für Kallistus ist Barmherzigkeit keine Option, sondern ein Prinzip kirchlicher Herrschaft. Sie erfordert zwar Unterscheidungsvermögen, verpflichtet uns aber, sie anzunehmen.
- Der Primat der Taufe: Entscheidungen über die Eheschließung und den Zugang zum Katechumenat zeigen, dass die Taufgnade die Identität der Menschen über den Personenstand hinaus wiederherstellt.
- Einheit in der Vielfalt: Das Schisma des Hippolytus zeigt, dass die Wahrheit sowohl durch Strenge als auch durch Laxheit gefangen gehalten werden kann. Kallistus sucht den katholischen Weg: breit, aber gerade; barmherzig, aber treu.
- Eine strukturierte Kirche: Katakomben, Disziplin, Ausbildung: Calixtus baut eine sichtbare, erinnernde und missionarische Kirche auf.
Wesentliche Chronologie
- Gegen Ende des 2. Jahrhunderts: Calixtus, ein christlicher Sklave, ist in eine Finanzverwaltung verwickelt, die sich als Desaster erweist.
- Zu einer Haftstrafe in den Bergwerken Sardiniens verurteilt; Begnadigung durch die Fürsprache einer dem kaiserlichen Hof nahestehenden Person.
- Rückzug aus Rom; Unterstützung von Papst Viktor; Studium der Heiligen Schrift.
- Unter Zephyrinus: Archidiakon; Entwicklung des Friedhofs der Via Appia (Katakomben von Saint-Calixte).
- 217: Zum Bischof von Rom gewählt.
- 217-222: Wichtige pastorale Maßnahmen (Buße, Katechumenat, sozial gemischte Ehen). Konflikt mit Hippolyt.
- 222: Martyrium während eines Aufruhrs in Trastevere; Beerdigung auf dem Friedhof von Calepoda, Via Aurelia.
Missverständnisse und historische Punkte
- Kallistus, doktrinär fragwürdig? Nein. Die Kritik von Hippolyt und bestimmten Rigoristen war heftig, aber die kirchliche Tradition erkennt die Orthodoxie des Kallistus an.
- Ein „Papst der Schwachen“? Er war vielmehr ein starker Pfarrer, der es wagte, Entscheidungen gegen die vorherrschende Meinung und sogar gegen das bürgerliche Recht zu treffen, wenn das Evangelium es verlangte.
- Die Katakomben, geheime Verstecke? Sie dienten zeitweise als Zufluchtsorte, vor allem aber als Gemeindenekropolen und Orte der Erinnerung und des Gebets.
Heiligkeit und Regierung: Eine anspruchsvolle Allianz
Die Leitung einer jungen Kirche erfordert die Wahrung von Lehre und Disziplin. Kallistus opfert keines von beiden. Er erweitert den Weg, ohne ihn zu vernichten. Seine Genialität liegt in einer pastoralen Lesart der Heiligen Schrift: Jesus schickt die Ehebrecherin nicht fort, um sie besser verurteilen zu können; er richtet sie auf, damit sie nicht mehr sündigt. Barmherzigkeit ist immer auf die Wahrheit ausgerichtet, und Wahrheit braucht, um heilsam zu sein, Barmherzigkeit.
Der Blick der Gegner: eine paradoxe Gnade
Paradoxerweise können die Aussagen von Gegnern die Statur eines Heiligen offenbaren. Die Pamphlete der Vergangenheit, manchmal ungerecht, zeigen dennoch, dass Kallistus die Grenzen verschoben hat. Er war ein Zeichen des Widerspruchs. Ein solches Zeichen ist in der Kirchengeschichte kein Makel, sondern oft das Zeichen einer Prophezeiung. In diesem Sinne bestätigt uns der rigorose Tertullian selbst in seiner Kritik der Barmherzigkeit, dass Kallistus eine brennende Frage stellte: Wie weit geht Vergebung? Die Antwort des Evangeliums ist klar: bis zum Ende.
Eine spirituelle Tour: Die Katakomben heute
Ein Besuch der sogenannten Kalixtus-Katakomben bedeutet, der Stille der Ursprünge zu begegnen. Die ausgehöhlten Gänge, die Nischen, die katechetischen Symbole sprechen noch immer. So verstehen wir, dass die Kirche seit jeher von der Gemeinschaft der Heiligen lebt: der Lebenden und der Toten, vereint in Christus. Diese Orte lehren Nüchternheit, Hoffnung und Geduld. Sie lehren uns, auf das ewige Leben zu warten wie auf die Morgendämmerung.

Calixtus und unsere Zeit: Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung
- Barmherzigkeit: Die Kirche unserer Zeit, die mit manchmal beispiellosen Wunden konfrontiert ist, findet in Calixtus ein Vorbild intelligenter Aufnahme, das den Ruf zur Umkehr nie aufgibt.
- Gerechtigkeit: Entscheidungen über die Eheschließung nehmen eine christliche Vision von Menschenwürde vorweg. Sie stellen unsere sozialen Strukturen in Frage: Welchen Platz geben wir schutzbedürftigen Menschen?
- Hoffnung: Die Katakomben symbolisieren hartnäckige Hoffnung. Wo die Geschichte zusammenzubrechen scheint, gräbt der Glaube Galerien aus Licht.
Spirituelle Meilensteine aus seinem Leben
- Der Sündenfall hat nicht das letzte Wort: Vom Bankrott zur Heiligkeit verkündet Callistus‘ Reise, dass Gott alles wiedergutmachen kann.
- Die Barmherzigkeit regiert: Sie ist kein Zusatz zur Seele, sondern das Rückgrat einer Kirche, die Christus ähnlich sein will.
- Der Preis der Einheit: Sie erfordert Vergebung, Geduld und Dialog mit den Gegnern, manchmal bis hin zur Spaltung.
- Erinnerung rettet: Die Organisation der Erinnerung (Katakomben) ist ein Akt des Glaubens. Sich erinnern heißt treu bleiben.
Gebet zum Heiligen Callistus I.
Gott der Barmherzigkeit, der dem Heiligen Callistus das Herz eines Hirten gab,
Du hast ihn aus der Erniedrigung emporgehoben und ihn zum Diener Deiner Kirche gemacht,
Mach uns zu Zeugen der Vergebung, die aufrichtet und heilt.
Durch seine Fürsprache lehre uns
ohne Berechnung willkommen zu heißen,
zu korrigieren, ohne zu verletzen,
unser Leben mit Wahrheit und Sanftmut zu führen.
Du, der du durch seinen Dienst die Tür zur Versöhnung geöffnet hast,
befähigt unsere Gemeinschaften, den Weg zurück nie zu verschließen,
um den Kleinen zu dienen,
und die Würde der Getauften über alle sozialen Barrieren zu stellen.
Stärke in unseren Prüfungen unsere Hoffnung.
Schaffen Sie Frieden in unseren Spaltungen.
Grabe in unserer Dunkelheit deine Lichtgalerien.
Heiliger Kallistus, Freund der Sünder und mutiger Hirte,
erlange für uns ein Herz wie deines,
treu bis zum Ende,
und fügsam gegenüber dem Geist, der alles neu macht.
Amen.
Um weiter zu gehen
Ohne die Anzahl der Referenzen zu erhöhen, können wir einige sichere Quellen beibehalten: das römische Martyrologium zur liturgischen Erinnerung; historische Aufzeichnungen aus römischen Traditionen (wie jene, die vom Liber Pontificalis inspiriert sind); die polemischen Zeugnisse des Hippolyt, die im Gegensatz dazu die Position des Kallistus beleuchten; und zeitgenössische katechetische Synthesen, die diese Quellen in ihrem Kontext ersetzen. Schließlich bietet der Besuch der Katakomben der Via Appia eine konkrete Erfahrung der römischen Kirche im 3. Jahrhundert.
Eine Figur für heute
Der heilige Kallistus I. flößt durch die Konsequenz seines Lebens Respekt ein. Aus dem gedemütigten Sklaven wurde ein demütiger Hirte; aus dem Gräberverwalter ein Schöpfer von Erinnerung und Hoffnung; aus dem umstrittenen Bischof ein verehrter Heiliger. In einer Zeit, in der die Kirche Treue zur Lehre und geistliche Gastfreundschaft zu vereinen sucht, erinnert uns Kallistus daran, dass die Wahrheit das Antlitz der Barmherzigkeit trägt und dass Barmherzigkeit, weit davon entfernt, eine Schwäche zu sein, die Stärke ist, die die Kirche aufrecht erhält. Seine Stimme, die aus den stillen Galerien der Via Appia erklingt, sagt uns erneut: Lasst uns keine Angst haben zu vergeben, denn Gott hatte keine Angst, uns bis zum Kreuz zu lieben.



