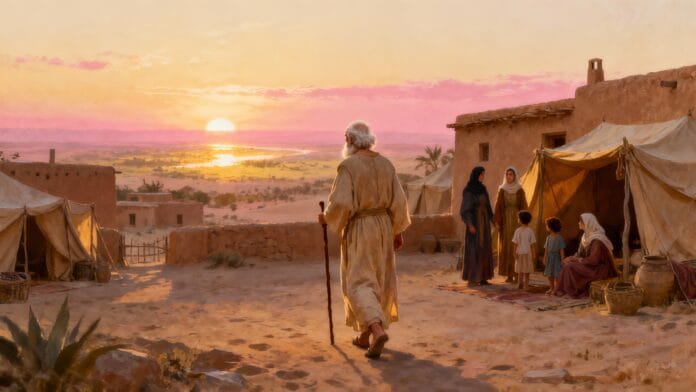Lesung aus dem Buch Genesis
Damals,
Der Herr sagte zu Abram:
„Verlasse dein Land,
deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters,
und geh in das Land, das ich dir zeigen werde.
Ich werde dich zu einer großen Nation machen,
Ich werde dich segnen,
Ich werde deinen Namen groß machen,
und du wirst ein Segen sein.
Ich werde diejenigen segnen, die dich segnen.
Wer dich verflucht, den werde ich verurteilen.
In dir wirst du gesegnet sein
alle Familien der Erde.“
Abram ging fort, wie der Herr es ihm gesagt hatte.
und Lot ging mit ihm.
– Wort des Herrn.
Aufbruch zur Wiedergeburt: Der Ruf Abrahams und die innere Revolution
Wenn Gott unsere Gewissheiten auf den Kopf stellt und uns das Unmögliche anbietet, wird der Glaube zum einzigen Weg zu einem neuen Leben..
Abrahams Berufung in Genesis 12,1-2 stellt weit mehr dar als eine ferne historische Episode: Sie eröffnet eine radikal neue Art des Daseins vor Gott und mit den anderen. Der 75-jährige Mann wird aufgefordert, alles zu verlassen – Vaterland, Familie, Elternhaus –, um in unbekannte Ferne aufzubrechen, geleitet nur von einer göttlichen Verheißung. Dieser grundlegende Bruch offenbart die tiefe Dynamik jedes authentischen spirituellen Lebens: den Verlust der eigenen Orientierung zu akzeptieren, um unendlich mehr zu empfangen, als man aufgibt. Abraham wird so zum Prototyp des Gläubigen, der einem Wort vertraut, bevor er seine Erfüllung sieht.
Wir werden zunächst den historischen und theologischen Kontext dieses Gründungsrufs untersuchen und dann die paradoxe Dynamik des gehorsamen Glaubens analysieren. Anschließend werden wir drei wesentliche Dimensionen vertiefen: Entwurzelung als Voraussetzung für Segen, Verheißung als treibende Kraft der Existenz und die universelle Berufung, die in der besonderen Erwählung liegt. Schließlich werden wir entdecken, wie spirituelle Tradition und praktisches Leben diesen abrahamitischen Mut heute verkörpern können.

Der biblische Kontext: Wenn Gott das Schweigen bricht
Ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte
Abrahams Berufung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt der biblischen Geschichte. Nach den ersten elf Kapiteln der Genesis, die von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut und der Zerstreuung der Völker in Babel berichten, ändert die Erzählung die Perspektive radikal. Bis dahin griff Gott weltweit ein, indem er sich an die gesamte Menschheit wandte oder ihre kollektiven Exzesse bestrafte. Mit Abraham verfolgte der Herr eine neue Strategie: Er erwählte einen bestimmten Mann, ein bestimmtes Volk, um alle Völker zu vereinen. Diese einmalige Erwählung ist kein exklusives Privileg, sondern ein universeller Dienst. Der Turmbau zu Babel hatte zur Sprachverwirrung und zur Zersplitterung der Menschheit geführt; Abrahams Berufung eröffnet den entgegengesetzten Weg, den der fortschreitenden Versöhnung aller Völker um einen gemeinsamen Segen herum.
Der biblische Text erzählt uns fast nichts über Abraham vor dieser Berufung. Wir wissen nur, dass er in Ur in Chaldäa lebte, einer Hochkultur in Mesopotamien, in der Polytheismus und Astrologie vorherrschten. Die jüdische Überlieferung berichtet später, dass Abraham den einen Gott durch seine eigene Reflexion entdeckte und die Götzen seiner Familie ablehnte. Doch der kanonische Text bleibt nüchtern: Es ist Gott, der die Initiative ergreift, der das Schweigen bricht, der in ein gewöhnliches Leben einbricht, um es in ein außergewöhnliches Schicksal zu verwandeln. Diese erzählerische Diskretion unterstreicht ein wesentliches Prinzip: Glaube entsteht nicht in erster Linie aus menschlicher Suche, sondern aus einem göttlichen Ruf. Nicht Abraham findet Gott, sondern Gott findet ihn und offenbart ihn sich.
Der Inhalt des Anrufs: Verlassen und Empfangen
Die göttliche Ordnung beinhaltet zwei scheinbar widersprüchliche, aber eng miteinander verbundene Bewegungen. Zunächst ein Bruch: „Verlasse dein Land, deine Familie und dein Vaterhaus.“ Diese dreifache Trennung – geographisch, stammes- und familiär – stellt ein völliges Losreißen von den natürlichen Bindungen dar, die die Identität eines Menschen in der Antike ausmachten. Abraham darf nicht einfach umziehen oder reisen; er muss akzeptieren, ein Fremder zu werden, die Wurzeln zu verlieren, die ihn nährten, und auf das Erbe zu verzichten, das ihn beschützte. Es ist eine vorweggenommene Trauer um alles, was seine menschliche Sicherheit ausmachte.
Doch dieser Bruch ist kein Selbstzweck: Er öffnet unmittelbar den Weg für eine überreiche Verheißung. „Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein.“ Die göttliche Logik widerspricht jeder Vernunft: Durch den Verlust seiner Sippe wird Abraham zum Vater einer großen Menge; durch das Verlassen seiner Heimat erhält er ein Land; durch seine Fremdheit wird er zur Quelle universellen Segens. Gott verlangt kein unfruchtbares Opfer, sondern eine fruchtbare Enteignung. Er will Abraham nicht verarmen lassen, sondern ihn von seinen Beschränkungen befreien, um ihm das Unbegrenzte anzubieten.
Das Ziel bleibt bewusst vage: „In das Land, das ich dir zeigen werde.“ Abraham erhält keine Karte, keine genaue Reiseroute, keine greifbare Garantie. Er muss aufbrechen, ohne zu wissen, wohin er geht, wie uns der Hebräerbrief in Erinnerung ruft. Diese Unbestimmtheit ist keine göttliche Grausamkeit, sondern eine geistliche Pädagogik: Sie verpflichtet Abraham, in reinem Vertrauen zu leben, seinen Glaubensakt täglich zu erneuern und sich nicht auf erworbenen Gewissheiten auszuruhen. Echter Glaube braucht nicht erst einen Beweis, sondern vertraut auf eine Person. Er verlässt sich nicht auf sichtbare Sicherheiten, sondern auf ein unsichtbares Wort.
Die unmittelbare Reaktion: Gehorchen ohne zu verhandeln
Der Rest der biblischen Geschichte besticht durch seine Nüchternheit: „Abram ging, wie der Herr es ihm gesagt hatte.“ Keine Diskussion, kein Einwand, keine Verhandlung. Anders als andere biblische Figuren wie Mose oder Jeremia, die lange mit Gott stritten, um ihre Mission zu verhindern, reagierte Abraham mit sofortigem Gehorsam. Diese Schnelligkeit bedeutet nicht, dass er die Gewalt des Weggerissenwerdens oder die Qual des Ungewissens nicht spürte. Vielmehr offenbart sie die Tiefe seines Vertrauens: Etwas in Gottes Wort berührte sein Herz so tief, dass er die Ungewissheit mit Gott der Sicherheit ohne ihn vorzog.
Dieser anfängliche Gehorsam wird zum Vorbild für Abrahams gesamtes Leben. Mehrmals muss er diesen Aufbruch wiederholen: Er verlässt Haran, zieht während der Hungersnot nach Ägypten, akzeptiert die Trennung von Lot, lässt sich mit 99 Jahren beschneiden und ist schließlich bereit, Isaak auf dem Berg Morija zu opfern. Jede Episode reproduziert die Grundstruktur von Genesis 12: ein überwältigender göttlicher Befehl, ein gehorchender Glaube, ein darauf folgender Segen. Der erste Ruf ist daher kein einmaliges Ereignis, sondern der Beginn eines Lebens, das ganz auf Zuhören und Vertrauen ausgerichtet ist. Abraham gehorcht nicht ein für alle Mal; er beschreitet einen Lebensweg, in dem Gehorsam zu seiner natürlichen Lebensader wird.
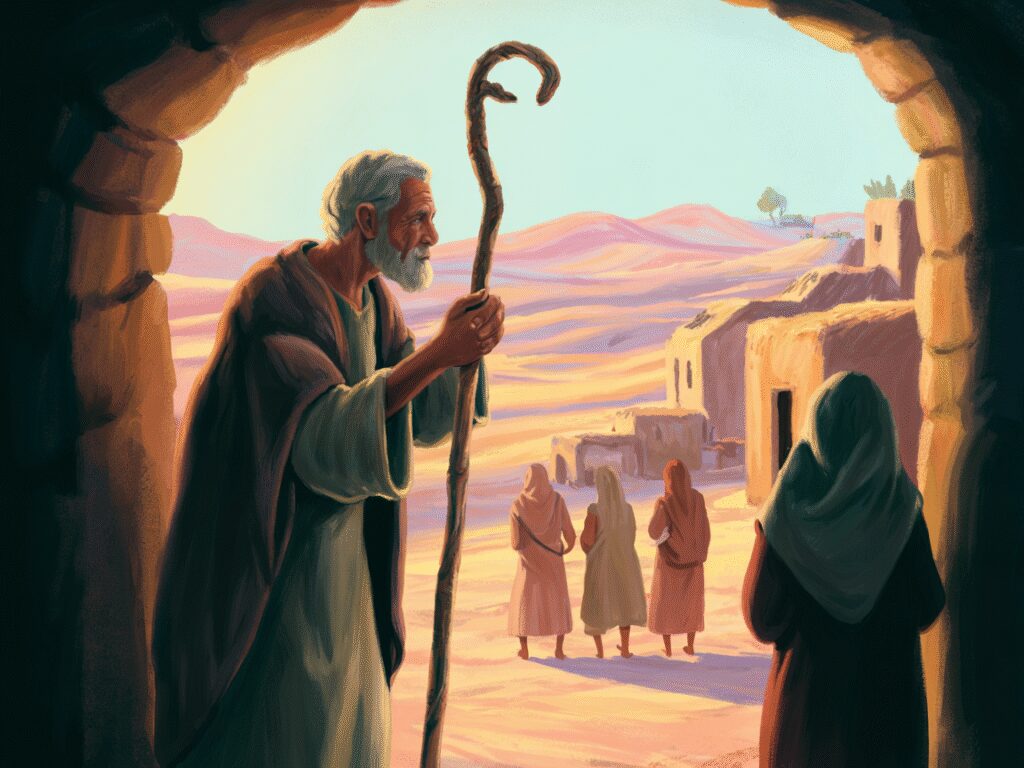
Analyse: Glaube als vertrauensvolle Hingabe
Das Abraham-Paradoxon
Im Kern von Abrahams Erfahrung liegt ein leuchtendes Paradoxon, das sich durch die ganze Bibel zieht: Wir besitzen nur wirklich, was wir bereit sind zu verlieren; wir erhalten nur vollständig, was wir nicht mehr kontrollieren wollen. Dieses kontraintuitive Prinzip widerspricht unserer natürlichen Logik, die auf Anhäufung, Sicherung und Kontrolle aus ist. Abraham hätte kalkulieren können: Ich bin alt, ich habe keine Kinder, ich besitze Eigentum – warum sollte ich das alles für ein vages Versprechen riskieren? Doch Glaube rechnet nicht, er vertraut. Er wägt keine Wahrscheinlichkeiten ab; er überlässt sich der göttlichen Treue.
Dieses Paradoxon findet seine radikalste Formulierung in der Episode von Isaaks Opferung. Gott verlangt von Abraham, den Sohn der Verheißung zu opfern, durch den sich alles Verheißene erfüllen sollte. Die menschliche Logik bricht zusammen: Wie kann sich die Verheißung erfüllen, wenn sein einziger Erbe getötet wird? Doch Abraham gehorcht, überzeugt davon, dass Gott die Toten auferwecken oder einen anderen unmöglichen Weg finden kann. Der Glaube ist nicht irrational, sondern überrational: Er leugnet die Vernunft nicht, führt sie aber über Abgründe hinweg, die der Verstand allein nicht überwinden könnte.
Gehorsam als Freiheit
Ein modernes Missverständnis sieht Gehorsam als Entfremdung, als unterwürfige Unterwerfung, die die persönliche Freiheit zerstört. Abrahams Erfahrung offenbart genau das Gegenteil: Gehorsam gegenüber Gott befreit von weitaus bedrückenderer menschlicher Knechtschaft. Indem er Ur verlässt, befreit sich Abraham von Götzendienst, sozialem Konformismus und familiärer Determiniertheit. Indem er einem transzendenten Ruf folgt, entkommt er dem immanenten Druck, der seine Existenz bestimmt hätte. Biblischer Gehorsam ist keine blinde Unterwerfung unter willkürliche Macht, sondern eine freie Antwort auf die Liebe, die ruft.
Diese neue Freiheit manifestiert sich in Abrahams Fähigkeit, in aktiver Erwartung zu leben. Er besitzt das Land noch nicht, lebt aber als Fremder dort, schlägt sein Zelt auf, errichtet Altäre und bezeugt seine Präsenz ohne Gewalt. Er hat noch keine Nachkommen, glaubt aber an die Verheißung, so sehr, dass er schon vor der Geburt eines zweiten Sohnes „Vater einer Menge“ genannt wird. Dieses Leben im „Noch nicht“ ist keine sterile Frustration, sondern eine Fruchtbarkeit anderer Art. Abraham entdeckt, dass man von Gottes Verheißungen leben kann, wie andere von ihrem Besitz leben – und sogar intensiver, denn das Warten vertieft das Verlangen, während der Besitz es trübt.
Der Segen, der zirkuliert
Der zweite Teil der Berufung wird oft weniger beachtet, ist aber ebenso wichtig: „Du wirst ein Segen sein […] In dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet.“ Abraham wird nicht nur für sich selbst gesegnet, sondern um ein Kanal des Segens für die ganze Menschheit zu werden. Diese universelle Dimension der besonderen Erwählung offenbart die göttliche Logik: Gott entscheidet sich für den Dienst, er segnet, damit der Segen zirkuliert, er gibt, damit andere im Gegenzug geben. Erwählung ist niemals ein egoistisches Privileg, sondern immer eine missionarische Verantwortung.
Diese universale Berufung, die in der Berufung Abrahams liegt, findet ihre endgültige Erfüllung in Jesus Christus, der dem Fleisch nach Abrahams Nachkomme ist, dem Geist nach aber Quelle des Segens für alle Völker. Der heilige Paulus entwickelt diese Theologie, indem er zeigt, dass alle Gläubigen Söhne Abrahams sind, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Der Segen Abrahams sollte daher nicht auf ein bestimmtes Volk beschränkt bleiben, sondern sich allmählich der gesamten Menschheit öffnen. Abraham wird so nicht nur zum Vater des jüdischen Volkes, sondern auch zum Vater aller Gläubigen, zum Prototyp des Menschen, der durch den Glauben und nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt ist.
Entwurzelung als Voraussetzung für Fruchtbarkeit
Verlassen, um zu finden
Der erste Satz des Aufrufs – „Geh aus deinem Land!“ – ist keine Strafe, sondern eine Läuterung. Abraham lebte in einer glanzvollen Zivilisation, im chaldäischen Ur, einer der fortschrittlichsten Städte seiner Zeit. Ur zu verlassen bedeutete, auf Komfort, kultivierte Kultur und etablierte soziale Strukturen zu verzichten. Doch diese äußeren Vorteile liefen auch Gefahr, die innere Stimme zu ersticken und das spirituelle Zuhören zu behindern. Indem Gott Abraham auffordert, zu gehen, nimmt er ihm nichts weg, sondern schafft Raum, ihm unendlich viel mehr zu bieten.
Diese geografische Entwurzelung symbolisiert eine tiefere, innere Entwurzelung: die Akzeptanz, nicht länger durch die eigene Herkunft, Vergangenheit und Errungenschaften definiert zu werden. Die natürliche menschliche Identität baut sich durch Anhäufung auf: Man ist ein Sohn von, ein Bürger von, ein Erbe von. Die spirituelle Identität baut sich laut Abraham auf, indem man sich selbst losreißt: Man wird ein Sohn der Verheißung, indem man aufhört, nur ein Sohn des Fleisches zu sein; man wird ein Bürger des Königreichs, indem man akzeptiert, ein Fremder auf Erden zu sein; man erbt Gott, indem man auf irdisches Erbe verzichtet. Dies ist keine Missachtung der Schöpfung, sondern eine gerechte Hierarchie der Bindungen: Gott über alles zu lieben, ermöglicht es einem letztendlich, jedes Ding an seinem rechtmäßigen Platz zu lieben.
Exil als spirituelle Pädagogik
Das Thema der Pilgerfahrt zieht sich durch Abrahams ganzes Leben. Er wird im Gelobten Land nie ein Steinhaus bauen, sondern immer in einem Zelt leben. Diese freiwillige Unsicherheit ist kein Masochismus, sondern tiefe Weisheit: Wer sich dauerhaft niederlässt, riskiert zu vergessen, dass er auf dem Weg in eine endgültige Heimat ist. Das Zelt erinnert ihn täglich an Zerbrechlichkeit, Abhängigkeit und die Notwendigkeit, auf Gott zu vertrauen, um Schutz und Nahrung zu erhalten. Es hält das Bewusstsein wach, dass diese Welt nicht das endgültige Ziel ist, sondern die Etappe auf dem Weg zu der „Stadt mit unerschütterlichen Fundamenten, deren Baumeister Gott ist“, wie es im Hebräerbrief heißt.
Diese Spiritualität der Pilgerfahrt nährt eine scheinbar widersprüchliche Doppelhaltung: Hingabe an die Gegenwart und Loslösung von ihr. Abraham widmet sich voll und ganz seinem irdischen Leben – er züchtet Schafe, schließt Bündnisse, kauft ein Grab, heiratet seinen Sohn –, ohne sich jedoch jemals wie auf eine absolute Grundlage zu beschränken. Er erfüllt seine Pflicht als Mensch, ohne seine Berufung als Fremder zu vergessen. Er kümmert sich um die irdischen Realitäten, ohne sich ihnen zu unterwerfen. Diese innere Freiheit inmitten äußerer Verpflichtungen kennzeichnet wahre Heiligkeit: ganz in der Welt präsent zu sein, ohne von ihr besessen zu sein.
Die paradoxe Fruchtbarkeit der Leere
Abrahams Entwurzelung hinterlässt eine schmerzliche Leere, doch genau diese Leere wird Gott auf neue Weise füllen. Solange Abraham in Ur blieb, umgeben von seiner Großfamilie, den Traditionen seiner Vorfahren und den kulturellen Gewissheiten, gab es keinen Raum für radikale Neuerungen. Indem Abraham die Leere akzeptierte – die geografische, genealogische (er ist kinderlos), die Leere ohne Garantien –, öffnete er einen Raum, in dem Gott kreativ wirken kann. Sarahs Unfruchtbarkeit wurde zum Ort einer wundersamen Geburt; die Negev-Wüste wurde zum Schauplatz göttlicher Begegnungen; die Einsamkeit des Exils wurde zum Schmelztiegel einer neuen Vertrautheit mit Gott.
Dieses spirituelle Prinzip bleibt ewig gültig: Gott füllt nur leere Hände, spricht nur zu schweigenden Herzen und führt nur diejenigen, die akzeptieren, dass sie den Weg nicht mehr kennen. Unsere menschliche Fülle – intellektuell, emotional, materiell – kann zum Hindernis werden, wenn sie uns die Illusion von Selbstgenügsamkeit vermittelt. Abrahams Selbstentäußerung ist keine Verleugnung irdischer Güter, sondern ein Verzicht darauf, dort unsere endgültige Sicherheit zu finden. Es bedeutet, die Armut vor Gott zu akzeptieren, um von ihm zu empfangen, was wir uns selbst nie geben könnten.

Das Versprechen als existenzielle Dynamik
Mehr von der Zukunft als von der Vergangenheit leben
Abraham begründete eine radikal neue Lebensweise: ein Leben, das sich an Gottes Zukunft orientiert und nicht an der Vergangenheit der Menschheit. Traditionelle Gesellschaften beziehen ihre Legitimität aus Tradition, Altertum und der Wiederholung des Gleichen. Mit Abraham beginnt eine Geschichte, die in eine unvorhersehbare Zukunft führt, geleitet von einem Versprechen, das immer weitergeht. Sein Leben wird nicht mehr von dem bestimmt, was war, sondern von dem, was sein wird; nicht von dem erhaltenen Erbe, sondern von der zu erfüllenden Mission; nicht von der Reproduktion des Gleichen, sondern von der Schaffung des Neuen.
Diese Zukunftsorientierung verändert das Verhältnis zur Zeit grundlegend. Der abrahamitische Gläubige erträgt den Lauf der Zeit nicht passiv, sondern bewohnt sie aktiv als Raum für die Reifung der Verheißung. Jeder Tag ist nicht einfach eine Wiederholung des vorherigen, sondern ein Schritt näher an die angekündigte Erfüllung. Das Warten ist nicht leer, sondern fruchtbar: Es trägt etwas in sich, das geboren werden wird. Diese aktive Geduld widersetzt sich sowohl der modernen Ungeduld, die alles sofort haben will, als auch der fatalistischen Resignation, die nichts mehr erwartet.
Glaube als Gewissheit unsichtbarer Realitäten
Der Hebräerbrief definiert Glauben als „die feste Zuversicht auf das, was man erhofft, der Glaube an das, was man nicht sieht“. Abraham veranschaulicht diese paradoxe Definition perfekt. Er hat keinen greifbaren Beweis für die Erfüllung der Verheißung, handelt aber, als sei sie bereits erfüllt. Er wird „Vater vieler“ genannt, obwohl er nur einen Sohn hat, und das auch nur durch ein spätes Wunder. Diese Erwartung ist keine Illusion, sondern Glaube: die Fähigkeit, das Unsichtbare zu sehen, das Stille zu hören, das Ungreifbare zu berühren, weil wir dem Wort Gottes mehr vertrauen als den Beweisen unserer Sinne.
Diese Gewissheit entspringt nicht einer Willensanstrengung, mit der Abraham sich zum Glauben zwingt. Sie entspringt der persönlichen Begegnung mit Gott, einer Begegnung, die sich sein ganzes Leben lang wiederholt. In jeder entscheidenden Phase – in Sichem, in Bethel, in Mamre, an der Eiche von More, auf dem Berg Morija – offenbart sich Gott Abraham, spricht zu ihm und bestätigt sein Versprechen. Glaube ist also kein abstraktes Festhalten an Lehren, sondern eine lebendige Beziehung zu jemandem, der sich schrittweise offenbart. Abraham glaubt nicht an Sätze, sondern an eine Person; er vertraut nicht einem System, sondern einem Gesicht.
Geduld, die das Versprechen reifen lässt
Zwischen der ersten Berufung im Alter von 75 Jahren und der Geburt Isaaks im Alter von 100 Jahren vergehen 25 Jahre. 25 Jahre des Wartens, der Hoffnung, manchmal des Zweifels, oft des Unverständnisses. Warum lässt Gott so lange, um zu erfüllen, was er versprochen hat? Diese lange Schwangerschaft ist keine Verzögerung, sondern ein Reifungsprozess. Gott lässt Abraham nicht aus Sadismus warten, sondern aus pädagogischen Gründen: Er reinigt sein Verlangen, vertieft seinen Glauben, erweitert seine Fähigkeit zu empfangen. Wäre Isaak sofort geboren worden, hätte Abraham ihn als Frucht seiner eigenen natürlichen Kraft betrachten können. Indem er auf wundersame Weise aus einem hundertjährigen Körper und einem unfruchtbaren Schoß geboren wurde, trägt Isaak in seinem Fleisch das unbestreitbare Zeichen göttlichen Eingreifens.
Diese göttliche Pädagogik des Wartens zieht sich durch die gesamte Heilsgeschichte. Die Patriarchen warteten Generationen lang auf das gelobte Land; Israel wartete Jahrhunderte lang auf den Messias; die Kirche wartet seit zwei Jahrtausenden auf die Wiederkunft Christi. Dieses Warten ist keine Zeit der Ruhe, sondern eine Zeit des Wachstums. Es lehrt Demut – man diktiert Gott keine Fristen; Vertrauen – Gott vergisst nicht, was er versprochen hat; Hoffnung – was sich verzögert, wird umso kostbarer sein, wenn es kommt. Warten schafft eine Leere in uns, die nur Gott füllen kann; es weitet unser Herz, sodass es mehr aufnehmen kann, als wir uns vorstellen konnten.
Wahl zur universellen Mission
Auserwählt, zu dienen
Ein tragisches Missverständnis durchzieht die Geschichte der Religionen: Erwählung wird mit exklusivem Privileg verwechselt, göttliche Erwählung mit Verachtung anderer. Abrahams Berufung offenbart eine genau entgegengesetzte Logik: Er wird nicht auserwählt, um von der Menschheit getrennt zu sein, sondern um ihr zu dienen; er wird gesegnet, nicht um den Segen zu behalten, sondern um ihn weiterzugeben; er wird zum Einzelnen, damit das Allgemeine ihn erreichen kann. Abrahams Segen ist kein Schatz, den man horten kann, sondern ein Fluss, der zu allen Völkern fließen soll.
Diese Struktur der Erwählung zur Mission erhellt die gesamte biblische Theologie. Israel wird nicht erwählt, weil es größer oder gerechter ist als andere Völker, sondern gerade weil es klein ist, sodass seine künftige Größe das Wirken Gottes und nicht menschlicher Verdienste deutlich zum Ausdruck bringen wird. Die Propheten, die Apostel, die Heiligen werden alle nach derselben Logik erwählt: nicht aufgrund ihrer persönlichen Vortrefflichkeit, sondern aufgrund des Dienstes, den sie leisten können. Sogar Christus, der Auserwählte schlechthin, kommt „nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“.
Der Segen, der sich vervielfacht
Die göttliche Ökonomie des Segens folgt einer Logik des Überflusses: Je mehr er zirkuliert, desto mehr vermehrt er sich; je mehr er geteilt wird, desto intensiver wird er. Abraham wird gesegnet, um zu segnen; er empfängt, um zu geben; er wird bereichert, um zu bereichern. Dieser Segenskreislauf steht im radikalen Gegensatz zur irdischen Wirtschaftslogik, in der Anhäufen Vorenthalten und Teilen Verarmung bedeutet. In der göttlichen Ökonomie bereichert Geben, während Vorenthalten verarmt; sich zu verschließen trocknet aus, und sich zu öffnen belebt.
Dieses geistliche Gesetz wird im Leben Abrahams konkret bestätigt. Als er Lot gegenüber großzügig ist und ihm den besten Teil des Landes überlässt, bestätigt Gott ihm sofort, dass das ganze Land ihm gehören wird. Als er für Sodom und Gomorra Fürsprache einlegt, obwohl diese Städte letztlich zerstört werden, offenbart sein Gebet ein Herz, das sich zu göttlichem Mitgefühl öffnet. Als er die drei geheimnisvollen Besucher in Mamre willkommen heißt, erhält er die Nachricht von der Geburt Isaaks. Jede Geste der Offenheit, des Teilens und der Fürbitte erweitert den Kanal, durch den göttlicher Segen zu ihm und durch ihn fließen kann.
Vater aller Gläubigen
Der heilige Paulus entwickelt diese universelle Dimension der abrahamitischen Berufung in den Briefen an die Römer und an die Galater auf großartige Weise. Abraham glaubte, bevor er beschnitten wurde; er wurde durch den Glauben gerechtfertigt, bevor er das Gesetz empfing. So wird er zum geistlichen Vater nicht nur der beschnittenen Juden, sondern aller Gläubigen, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Abrahams Vaterschaft geht über biologische Generationen hinaus und schafft eine universelle geistliche Familie. Alle, die auf Gott vertrauen, wie Abraham auf ihn vertraute, werden durch den Glauben seine Söhne und Töchter.
Diese universelle Öffnung erfüllt die ursprüngliche Verheißung: „In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden.“ Jesus Christus, der Nachkomme Abrahams, wird zum Mittler, durch den dieser Segen tatsächlich alle Völker erreicht. Das Kreuz Christi zerreißt den Schleier, der Juden und Heiden trennte; die Auferstehung eröffnet eine neue Schöpfung, in der es „weder Juden noch Griechen“ gibt. Die entstehende Kirche, die sich aus allen Völkern zusammensetzt, macht die Erfüllung der Abraham gegebenen Verheißung sichtbar: Ihre geistliche Nachkommenschaft ist so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer.
Spirituelle Tradition
Die Kirchenväter und Abraham
Die patristische Tradition hat unermüdlich über die Gestalt Abrahams nachgedacht und in ihm zugleich ein Vorbild geistlichen Lebens und eine Vorwegnahme der christlichen Mysterien gesehen. Der heilige Augustinus betont, dass Abrahams Glaube „nicht über die Unermesslichkeit der Verheißungen erstaunt“ sei: Er empfängt das göttliche Wort mit Einfachheit und Erhabenheit, ohne die Kluft zwischen Verkündigung und Erfüllung zu bemessen. Diese Einfachheit ist keine Naivität, sondern Tiefe: Wer Gott wirklich kennt, weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist.
Der heilige Kyrill von Alexandria entwickelt eine typologische Lesart von Isaaks Opfer: Abraham repräsentiert Gottvater, der seinen einzigen Sohn zur Welt bringt; Isaak trägt das Opferholz, wie Jesus das Kreuz tragen wird; der Widder der Vorsehung stellt den stellvertretenden Christus vorweg. Diese symbolische Lesart leugnet nicht die Historizität der Geschichte, sondern offenbart ihre theologische Bedeutung: Die gesamte Geschichte Abrahams ist auf Christus ausgerichtet und kann nur in ihm vollständig verstanden werden. Der heilige Irenäus stellt fest, dass Abraham schon vor seiner Menschwerdung „dem Wort folgte“, was darauf hindeutet, dass der präexistente Christus den Patriarchen bereits auf den Wegen nach Kanaan führte.
Die Spiritualität der Verlassenheit
Die christliche spirituelle Tradition entwickelte insbesondere ab dem 17. Jahrhundert eine Theologie der „Hingabe an die göttliche Vorsehung“, die direkt in der abrahamitischen Erfahrung wurzelt. Jean-Pierre de Caussade, ein französischer Jesuit, lehrte, dass Hingabe an Gott keine passive Resignation, sondern aktives Vertrauen bedeutet: die Akzeptanz, dass Gott alles, auch scheinbar Ungünstige, zu einem Guten führt, das wir noch nicht erkennen können. Wie Abraham, der aufbrach, ohne zu wissen, wohin er ging, schreitet der Christ voran, indem er auf göttliche Weisheit statt auf seinen eigenen Verstand vertraut.
Charles de Foucauld fasste diese Spiritualität in seinem berühmten „Gebet der Hingabe“ zusammen: „Mein Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was du willst.“ Dieses Gebet greift die Struktur von Abrahams Berufung auf: die eigenen Pläne aufzugeben, um Gottes Plan anzunehmen; auf Kontrolle zu verzichten, um Vertrauen zu entwickeln; das Unverständnis zu akzeptieren, um ganz lieben zu können. Die heilige Therese von Lisieux sprach vom „kleinen Weg“, diesem kindlichen Vertrauen, das sich ohne Berechnung und Abwägung in die Hände des Vaters begibt, einfach weil sie weiß, dass sie geliebt wird.
Die göttliche Pädagogik der Loslösung
Die großen spirituellen Meister, von Johannes vom Kreuz bis Franz von Sales, haben alle über die Notwendigkeit der Loslösung meditiert, die Abraham verkörperte. Keine eisige Loslösung, die Geschöpfe verachtet, sondern eine liebevolle Loslösung, die sie in Gott und für Gott liebt, statt in sich selbst und für sich selbst. Abraham liebt Sarah, doch seine wahre Sicherheit liegt in Gott; er schätzt Isaak, ist aber bereit, ihn dem zurückzugeben, der ihn ihm geschenkt hat; er sehnt sich nach dem gelobten Land, ist aber bereit, dort als Fremder zu leben. Diese paradoxe Loslösung ermöglicht eine tiefere Bindung, frei von Besitzgier und Angst.
Diese spirituelle Weisheit spiegelt die tiefsten Erkenntnisse der Philosophie wider: Wir besitzen nur das, was wir verlieren können, ohne zerstört zu werden. Wer ohne eine bestimmte Person, einen bestimmten Besitz, eine bestimmte Situation nicht leben kann, ist in Wirklichkeit ein Sklave dessen, was er zu besitzen glaubt. Abraham, der akzeptierte, potenziell alles zu verlieren, entdeckte, dass er in Wirklichkeit alles besitzt, weil er Gott besitzt, und dass derjenige, der Gott besitzt, alles in sich selbst besitzt. „Gott allein ist genug“, sagte Teresa von Avila, ein entferntes Echo abrahamitischer Freiheit.
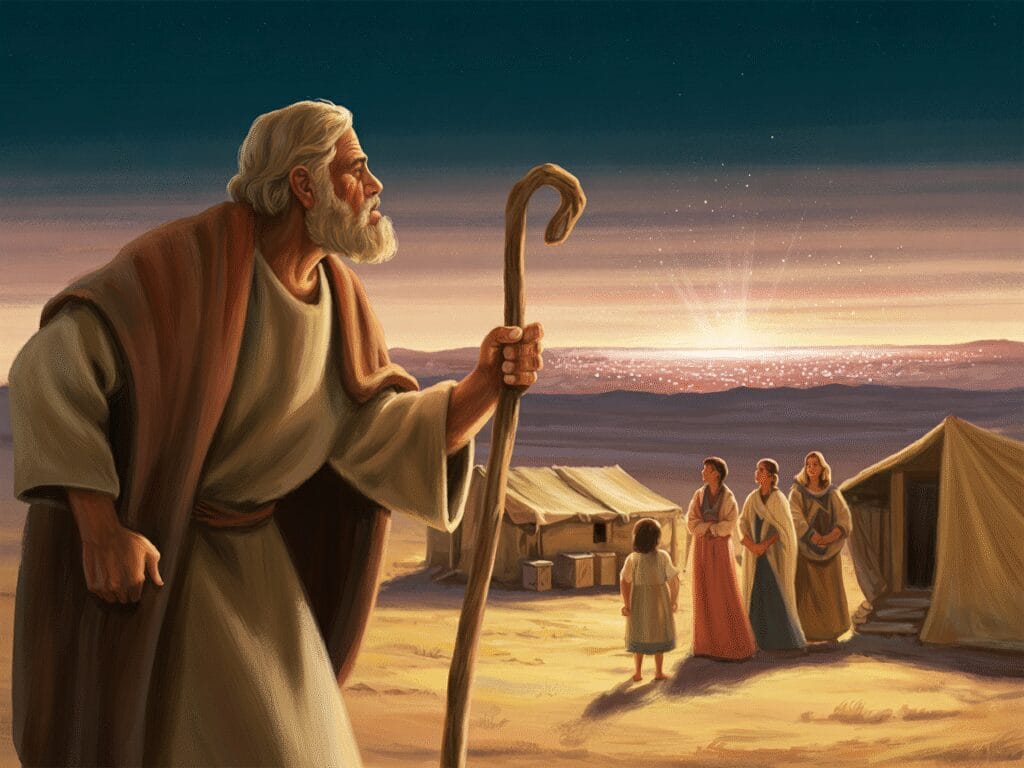
MeditationS
Um die Dynamik Abrahams in unserem heutigen konkreten Leben zu verkörpern, finden Sie hier einige praktische Schritte zum Meditieren und Erfahren:
Identifizieren Sie unsere persönlichen URs. Nehmen Sie sich die Zeit, zu erkennen, was in unserem gegenwärtigen Leben unsere menschlichen Sicherheiten ausmacht – Beziehungen, Besitztümer, Status, Gewohnheiten – an denen wir vielleicht übermäßig hängen. Nicht, um sie zu verachten, sondern um sie in eine klare Beziehung zu Gott zu setzen.
Pflegen Sie das innere Zuhören. Abraham hörte Gottes Ruf, weil er ein guter Zuhörer war. Er sorgte regelmäßig für Momente der Stille, fernab von Lärm und Hektik, damit Gottes Wort in unser Bewusstsein gelangen konnte.
Akzeptieren Sie eine „kleine Abweichung“. Wählen Sie konkret einen begrenzten, aber bedeutsamen Verzicht – eine bequeme Gewohnheit, eine toxische Beziehung, ein Projekt, das uns belastet – als Übung in Gehorsam und Vertrauen. Lassen Sie ein wenig, um zu lernen, mehr zu lassen.
Lebe nach Versprechen, nicht nach Besitz. Vertrauen Sie in Situationen der Erwartung oder Unsicherheit eher auf Gottes Treue als auf Ihre eigene Kontrolle. Meditieren Sie über biblische Versprechen, die für Sie eher solide Realitäten als greifbare Beweise darstellen.
Werden Sie zu einem Kanal des Segens. Finden Sie heraus, wie wir anderen ein Segen sein können: Wem können wir Mut machen, wem können wir helfen, wem können wir zuhören, wem können wir dienen? Der empfangene Segen muss zirkulieren, damit er nicht stagniert.
Leben als Pilger. Auch wenn wir in einem stabilen Leben leben, sollten wir eine innere Haltung der Pilgerschaft pflegen: uns daran erinnern, dass diese Welt nicht unsere endgültige Heimat ist, sondern dass wir auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem sind. Dieses Bewusstsein relativiert irdische Misserfolge, ohne die gegenwärtigen Verpflichtungen außer Acht zu lassen.
Unsere Geschichte im Licht der Vorsehung neu lesen. Schauen Sie regelmäßig zurück, um zu erkennen, wie Gott unser Leben geführt hat, oft auf eine Weise, die wir nie gewählt hätten. Dieses erneute Lesen stärkt das Vertrauen für die nächsten Schritte.
Fazit: Die Kühnheit, alles auf ein Wort zu setzen
Abrahams Berufung in Genesis 12,1-2 ist nicht nur eine grundlegende Episode der biblischen Geschichte; sie offenbart die fortwährende Struktur allen authentischen spirituellen Daseins. Aufbrechen, vertrauen, gehorchen, warten, empfangen, weitergeben: Diese abrahamitischen Verben skizzieren den Weg allen Lebens, der Gott dargeboten wird. Dieser Weg ist weder bequem noch vorhersehbar, aber er ist der einzige, der zu wahrer Erfüllung führt.
In unserer Zeit stehen Sicherheit, Kontrolle und sorgfältige Zukunftsplanung im Vordergrund. Abraham erinnert uns daran, dass es noch eine andere Weisheit gibt: die Kühnheit, alles auf ein Wort zu setzen, die Torheit, das Unsichtbare dem Sichtbaren vorzuziehen, den Mut, zu verlieren, um unendlich mehr zu gewinnen. Diese Weisheit ist nicht nur außergewöhnlichen Helden vorbehalten, sondern steht jedem Gläubigen offen. Gott ruft heute wie vor 4.000 Jahren Männer und Frauen dazu auf, ihr persönliches Ur zu verlassen und ins unberechenbare Kanaan zu ziehen.
Dieser Ruf erreicht uns in unserer konkreten Situation: unseren Ängsten, unseren Bindungen, unseren umsichtigen Berechnungen. Aber er erreicht uns auch in unserem tiefen Wunsch nach einem sinnvollen Leben, nach einer Existenz, die etwas Größerem dient als unseren kleinen Annehmlichkeiten. Abraham lehrt uns, dass es möglich ist, anders zu leben, geleitet nicht von der Angst vor dem Morgen, sondern vom Vertrauen auf den Einen, der alle Morgen geschaffen hat. Dieses Leben des Glaubens ist keine Flucht vor der Realität, sondern ein tieferes Eintauchen in die ultimative Realität, die unsere Sinne noch nicht wahrnehmen, die unser Herz aber bereits spüren kann.
Die letzte Einladung ist einfach und radikal: Wollen wir auf unsere Weise, in unserer Zeit und unter unseren besonderen Umständen wie Abraham antworten: „Hier bin ich“? Diese Bereitschaft, dem göttlichen Ruf zu folgen, wie auch immer er konkret aussehen mag, verwandelt jedes Leben in ein geistliches Abenteuer. Sie macht uns wie Abraham zu Pilgern, die Segen bringen, zu Gläubigen, die im Unsichtbaren verwurzelt sind, zu lebendigen Zeugen dafür, dass Gott sein Wort hält und dass Vertrauen in sein Wort niemals Torheit, sondern höchste Weisheit ist.
Praktisch
- Meditiere täglich über Genesis 12:1-9 Bitten Sie den Heiligen Geist, diese Berufung für Ihr persönliches Leben heute zu verwirklichen.
- Üben Sie ein „Sicherheitsfasten“ Einmal pro Woche: Gewohnte Kontrolle aufgeben, um Vertrauen in die göttliche Vorsehung zu üben.
- Ein spirituelles Tagebuch führen wo die eingegangenen Anrufe, die geleisteten Gehorsamsübungen und die im Laufe der Monate beobachteten Früchte des Vertrauens in Gott notiert werden können.
- Lesen Sie Hebräer 11 als Ergänzung: die Galerie der Glaubenszeugen, die alle auf ihre Weise Abraham auf ihrem spirituellen Weg nachgeahmt haben.
- Die Wahl eines „abrahamitischen Reisebegleiters“ : ein Freund oder spiritueller Führer, mit dem man die Etappen der inneren Pilgerreise teilen und sich gegenseitig ermutigen kann.
- Üben Sie universelle Fürbitte wie Abraham, der für Sodom betete: Erweitern Sie sein Gebet über seinen unmittelbaren Kreis hinaus, um zu einem Kanal des Segens zu werden.
- Die Tugend der Gastfreundschaft pflegen was Abraham in Mamre auf großartige Weise praktizierte: Den Fremden willkommen zu heißen, bedeutet manchmal, Gott selbst in einem unerwarteten Gesicht willkommen zu heißen.
Verweise
Wichtigste biblische Texte
- Genesis 12:1-9 (Abrahams Berufung und Abreise)
- Genesis 15 (der göttliche Bund und die Verheißung der Nachkommenschaft)
- Genesis 22 (das Opfer Isaaks und der höchste Glaube)
- Römer 4 (Abraham wird durch Glauben gerechtfertigt, nicht durch Werke)
- Galater 3:6-9 (alle Gläubigen sind durch den Glauben Söhne Abrahams)
- Hebräer 11:8-19 (Abraham, Glaubensvorbild für die Kirche)
Patristische Tradition
- Heiliger Augustinus, Predigten zur Genesis (Kommentare zu Abraham)
- Heiliger Kyrill von Alexandria, Glaphyra in Genesim (typologische Lesart)
- Heiliger Irenäus von Lyon, Gegen Häresien (Abraham folgt dem Wort)
Christliche Spiritualität
- Jean-Pierre de Caussade, Ergeben Sie sich der göttlichen Vorsehung (18. Jahrhundert)
- Charles de Foucauld, Gebet der Verlassenheit und spirituelle Schriften
- Therese von Lisieux, Geschichte einer Seele (der kleine Pfad des Vertrauens)
Zeitgenössische theologische Studien
- Bibelkommentare zur Genesis (historisch-kritische und spirituelle Exegese)
- Bundestheologie (reformierte und katholische Perspektive)
- Studien zum abrahamitischen Glauben im Judentum, Christentum und Islam