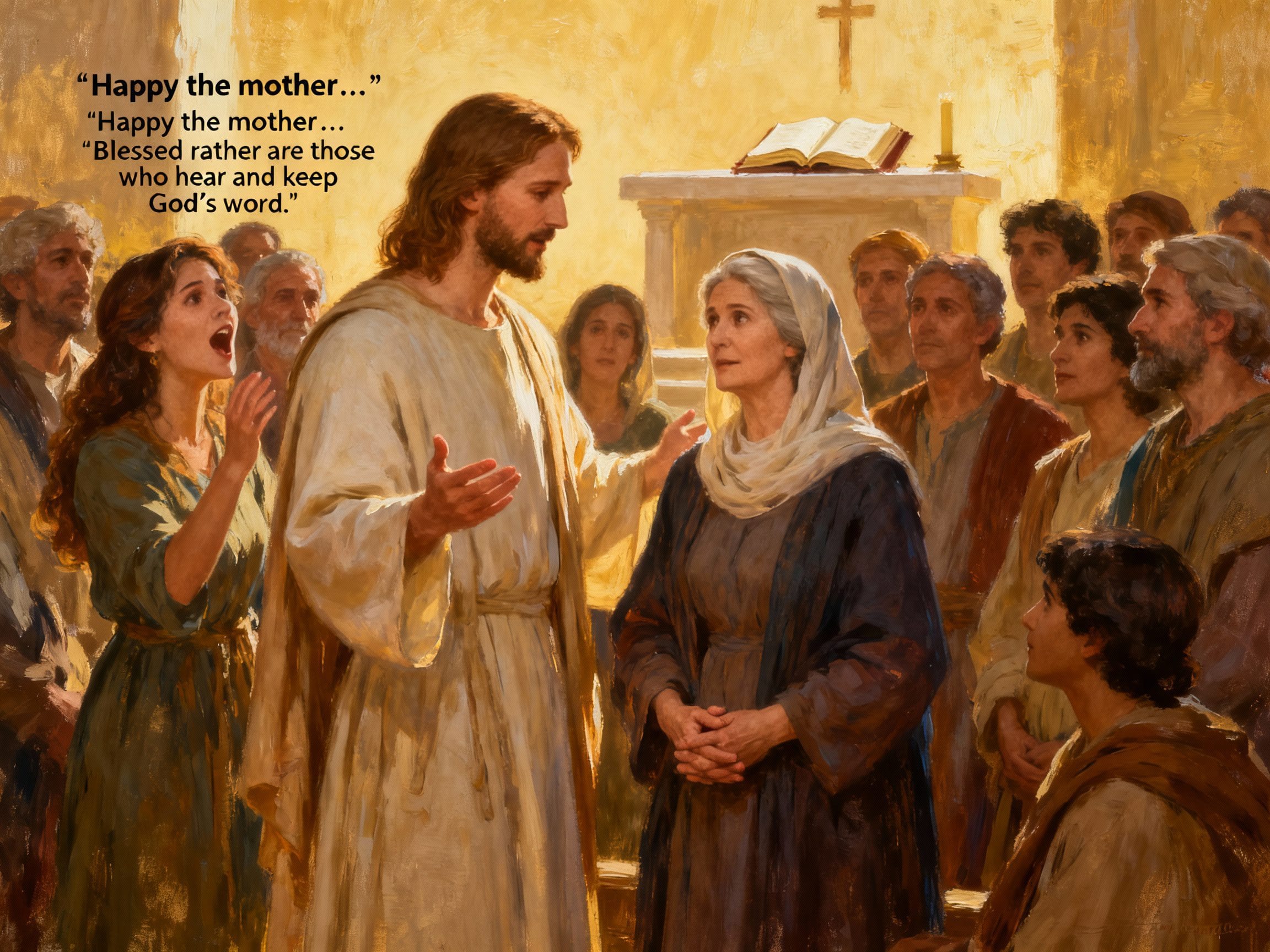Evangelium Jesu Christi nach Lukas
Damals,
als Jesus sprach,
eine Frau erhob ihre Stimme mitten in der Menge
um ihm zu sagen:
„Gesegnet sei die Mutter, die dich in ihrem Leib getragen hat,
und deren Brüste dich genährt haben!“
Da sagte Jesus zu ihm:
„Vielmehr sind diejenigen gesegnet, die das Wort Gottes hören,
und wer es behält!“
– Lasst uns das Wort Gottes bejubeln.
Der kurze Dialog im Lukasevangelium (11,27-28) stellt zwei Arten, Jesus zu preisen, gegenüber: das Lob an die Mutter und das Wort des Meisters, der die Seligkeit an diejenigen weiterleitet, die auf das Wort Gottes hören und es befolgen. Diese kurze Geschichte, die in der Liturgie gelesen und verkündet wird, lädt zu einer tiefgreifenden Umkehr in unserem Glaubensverständnis ein: Es genügt nicht, äußere Zeichen der Heiligkeit zu erkennen oder Akklamationen auszusprechen, wir müssen gehorsame Hörer des Wortes werden, das rettet. Der Text beleuchtet auch den Platz Marias in der katholischen Tradition: Sie wird gepriesen, aber das höchste Lob gilt denen, die das Wort leben; und gerade Maria ist das Vorbild par excellence des gehorsamen Hörens. Ausgehend vom Text werden wir eine Meditation entwickeln, die in vier Teile gegliedert ist: 1) aufmerksame Lektüre des Textes und des liturgischen Kontexts; 2) theologische Bedeutung des Gegensatzes „selige Mutter“ / „diejenigen, die auf das Wort Gottes hören“; 3) spirituelle und praktische Implikationen für das tägliche Leben; 4) patristische Wurzeln und der Platz Marias in der katholischen liturgischen Tradition. Wir schließen mit einigen konkreten Vorschlägen für das Gebet und das kirchliche Leben.
Sorgfältiges Lesen des Textes und des liturgischen Kontextes
Der zentrale Vers: „Selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und befolgen!“ ist Teil eines größeren Ganzen, in dem Jesus über das Gebet (insbesondere das Vaterunser) und den Kampf gegen das Böse lehrt (vgl. Lukas 11). Ein auffälliges Element ist dabei der spontane Ruf einer Frau inmitten der Menge: „Gesegnet sei die Mutter, die dich geboren hat…“ (V. 27). Dieser verständliche und natürliche Ruf unterstreicht die allgemeine Bewunderung für die Mutterschaft und die fleischliche Intimität Marias. Die Anerkennung der Würde der Mutter des Messias ist im Mund des Volkes eine Reaktion der Frömmigkeit und Menschlichkeit.
Jesus korrigiert das Lob Marias jedoch nicht durch Ablehnung, sondern durch eine Neuorientierung: Er gibt der Seligpreisung einen neuen Rahmen, indem er sie auf das Hören und die Treue zum Wort Gottes legt. Der griechische Ausdruck, der mit „auf das Wort hören“ (akouein ton logon tou theou) wiedergegeben wird, erinnert an die große biblische und prophetische Bedeutung des Hörens in der jüdischen Tradition: Israel ist aufgerufen zu „hören“, um zu gehorchen (Deuteronomium, Gesetz), da Hören eine Bedingung des Bundes ist. Jesus erhebt das Hören auf das Wort Gottes somit zur Seligpreisung, die alle betrifft, die Gott nachfolgen.
Liturgisch wird dieser Abschnitt im Halleluja bejubelt und in der Kirche verkündet, um an den Primat des Wortes im christlichen Leben zu erinnern. Die Liturgie stellt das Hören des Wortes in den Mittelpunkt der Versammlung: Während der Messe wird das Wort Gottes verkündet, bejubelt, meditiert und bereitet die Gemeinde auf den Empfang der Eucharistie vor. Die Bedeutung des „Bewahrens des Wortes“ bezieht sich auf die Treue zur Eucharistie: Wort und Eucharistie gehören in der katholischen liturgischen Tradition zusammen.
Tiefe theologische Bedeutung: Sprechen, Zuhören, Treue
Das Wort als lebendige Präsenz
In der christlichen Tradition ist das Wort nicht nur eine Botschaft, sondern eine Gegenwart: der fleischgewordene Logos, Christus. Wenn Jesus sagt: „Selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören“, meint er das Hören auf das Wort, das das Leben verwandelt, das Annehmen dessen, der spricht, und dessen, an den sich jemand wendet. Wahres Hören beinhaltet eine persönliche Begegnung mit Gott, eine innere Haltung, die zugleich Zustimmung des Willens ist. Die Kirche bekräftigt in ihren Kirchenvätern, dass das Hören des Wortes zur Aufnahme Christi führt. Augustinus schreibt oft, dass Verstehen und Glauben untrennbar miteinander verbunden sind: Glauben bedeutet, das Wort Christi aufzunehmen und im Herzen zu bewahren (vgl. Predigten des Augustinus). Johannes Chrysostomus betont die verwandelnde Kraft des verkündeten Wortes: Es wirkt auf die Seele.
Zuhören ≠ einfaches Hören
Das Hören auf das Wort Gottes geht über die bloße Hörwahrnehmung hinaus. Es ist ein gehorsames Hören (akoe + hupakoe), bei dem das Wort zur Lebensnorm wird. Das Wort „bewahren“ (tèréin ton logon) bedeutet, es in die Tat umzusetzen, Treue. In der biblischen Tradition bedeutet „bewahren“ auch, darüber nachzudenken (vgl. Psalm 1), es in sich zu tragen und danach zu leben. Jesus zeigt durch diese Korrektur, dass das Wesentliche nicht die biologische Beziehung zu ihm ist (auch wenn sie in Maria real und kostbar ist), sondern die geistliche Zugehörigkeit, die aus dem Gehorsam gegenüber dem Wort erwächst.
Maria, ein Vorbild des Zuhörens
Für die katholische Theologie besteht kein Widerspruch zwischen dem Wort Jesu und der Maria zuteil werdenden Ehre. Maria ist vielmehr das paradigmatische Beispiel einer Person, die auf das Wort hört und es befolgt: Sie hörte die Verkündigung des Engels (Lk 1,26-38), meditierte über die Ereignisse (Lk 2,19.51), bewahrte den Glauben unter dem Kreuz (Joh 19,25) und war mit den Aposteln im Abendmahlssaal im Gebet (Apg 1,14). Kirchenväter wie Ambrosius von Mailand und Hieronymus sehen in Maria die Grundlage des vollkommenen Glaubens – sie ist gesegnet, gerade weil sie hörte und befolgte. Jesu Warnung lehnt Maria also nicht ab, sondern stellt sie als vorbildliche Ikone dar: Ihre fleischliche Mutterschaft hat eine radikal spirituelle Bedeutung, wenn sie in Hören auf das Wort und Treue ihm gegenüber umgesetzt wird.

Spirituelle und praktische Auswirkungen auf das tägliche Leben
Ein Zuhörer des Wortes werden
Der pastorale Imperativ, der sich aus diesem Vers ergibt, ist klar: Die Kirche ruft nicht zur unentgeltlichen Bewunderung auf, sondern zur Bekehrung durch Zuhören. Konkret bedeutet, ein Hörer des Wortes zu werden:
- Regelmäßiges Bibellesen. Dies kann Lectio Divina sein, eine traditionelle Methode, die Lesen, Meditation, Gebet, Kontemplation und Handeln verbindet. Lectio hilft uns, nicht an der Oberfläche des Textes zu bleiben, sondern das Wort in unseren Herzen keimen zu lassen.
- Aktive Teilnahme an der Liturgie: Bei den Lesungen anwesend sein, aufmerksam zuhören, die Predigt nicht als Moment der Ablenkung, sondern als geistliche Nahrung annehmen. Die Predigt soll zum aktiven Zuhören und Umsetzen anregen.
- Zuhören im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet: Nehmen Sie sich Momente des stillen Zuhörens, schalten Sie den Lärm aus und lassen Sie das Wort wirken.
Das Wort im täglichen Handeln bewahren
Das Wort Gottes zu bewahren bedeutet, es in die Tat umzusetzen. Christliche Treue misst sich an der Fähigkeit, das Evangelium in konkrete Taten umzusetzen: Nächstenliebe gegenüber den Armen, ethische Entscheidungen am Arbeitsplatz, Vergebung in der Familie, Respekt vor der Wahrheit. Einige praktische Anwendungen:
- Familie und Zuhause: Gemeinsam als Familie die Bibel lesen, die Bedeutung des wöchentlichen Evangeliums teilen, Kindern beibringen, zuzuhören und mit einfachen Hilfsbereitschaften zu reagieren.
- Berufsleben: Lassen Sie sich bei ethischen Entscheidungen vom Wort Gottes leiten, wie Sie Kollegen, Kunden und Untergebene behandeln und üben Sie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Freundlichkeit.
- Soziales und politisches Leben: Verwechseln Sie nicht Glauben und Ideologie, sondern lassen Sie sich beim sozialen Engagement vom Wort Gottes leiten – Solidarität, Unterstützung der Ausgegrenzten, Verteidigung der Menschenwürde.
Zuhören als Gemeinschaftsaktivität
Die Erlösung ist kein rein individueller Weg; Zuhören und Treue werden innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft geübt. Die Gemeinde ist der Leib, in dem das Wort empfangen und lebendig gemacht wird. Deshalb:
- Fördern Sie Räume für den Austausch über die Bibel in kleinen Gruppen, in denen wir gemeinsam zuhören und die Bibel in die Praxis umsetzen.
- Fördern Sie die kontinuierliche katechetische Ausbildung für alle Altersgruppen, denn Zuhören bedeutet auch Verstehen.
- Unterstützen Sie Wohltätigkeits- und Dienstbewegungen als konkreten Ausdruck der Sorge um das Wort.
Widerstehen Sie der Versuchung des Scheins
Der Text warnt vor der Versuchung, äußere Zeichen – Titel, Feiern, Manifestationen – auf Kosten der inneren Treue zu priorisieren. Eine lebendige Kirche ist eine, die auf die Bekehrung des Herzens hinarbeitet. Der Schein kann verführerisch sein: Bewunderung für eine Figur, liturgischer Eifer, Hingabe ohne Bekehrung. Jesu Botschaft führt uns zurück zum Wesentlichen: völlige Treue zu Gott, ausgedrückt durch Gehorsam und dessen Umsetzung in die Praxis.

Patristische Resonanzen und liturgische Tradition
Kirchenväter über das Hören und Bewahren des Wortes
- Der heilige Augustinus: Für Augustinus muss das Wort Gottes verinnerlicht werden. In seinen Predigten und Bekenntnissen zeigt er, wie die hörende Seele vom Wort erfüllt wird und wie der Glaube Affektivität und Willen verändert. Augustinus verwendet das Bild des inneren Gefäßes, das den Samen des Wortes aufnimmt.
- Johannes Chrysostomus: Berühmt für seine Predigten, betonte er die Beziehung zwischen Predigt und Bekehrung. Er kritisierte seine Zuhörer oft dafür, dass sie zuhörten, ohne ihr Leben zu ändern. Für ihn bedeutete das „Befolgen“ des Wortes, es konkret zu leben, insbesondere in brüderlicher Nächstenliebe.
- Ambrosius von Mailand und Gregor der Große: Sie sehen in Maria das Vorbild der hörenden und hütenden Seele. In seiner Abhandlung über Maria betont Ambrosius die geistige Mutterschaft und den vorbildlichen Glauben der Jungfrau als Abbild der Kirche, die das Wort empfängt.
- Der heilige Basilius und Kyrill von Alexandria betonen die Bedeutung des fleischgewordenen Wortes und die liturgische Dimension des Zuhörens und zeigen, dass sakramentale Handlung und Wort zusammengehören.
Maria in der katholischen liturgischen Tradition
Die katholische Liturgie steht der Verehrung der Jungfrau Maria und dem Primat Christi und seines Wortes niemals entgegen. Riten, Hymnen und Antiphonen ehren Maria als Paradigma des Glaubens. Zum Beispiel:
- Das Ave Maria und das Magnificat: Das Magnificat ist das Gebet schlechthin des Zuhörens und Jubelns vor Gott: Maria nimmt die Verkündigung an und ihr Gebet bringt den Glauben zum Ausdruck, der das Wort bewahrt und verherrlicht.
- Die Marienantiphonen und die Feste des liturgischen Kalenders (Unbefleckte Empfängnis, Mariä Himmelfahrt) schreiben Maria als Vorbild der Kirche in die Heilsgeschichte ein.
- Die Praxis der Lectio Divina und die Präsenz des Wortes in den Gottesdiensten laden uns ein, der Treue nachzueifern, die Maria gelebt hat.
Liturgie und Pastoral: Praxis
Die Liturgie muss die Zuhörer formen: Die Anordnung der Verkündigungszeiten (Minimierung des Lärms, Sicherstellung einer guten Aussprache), die Qualität der Predigten (kurz, konzentriert, praktisch), die musikalische Begleitung zur Förderung der Innerlichkeit – all dies hilft der Gemeinde, dem Wort zuzuhören und es zu bewahren.
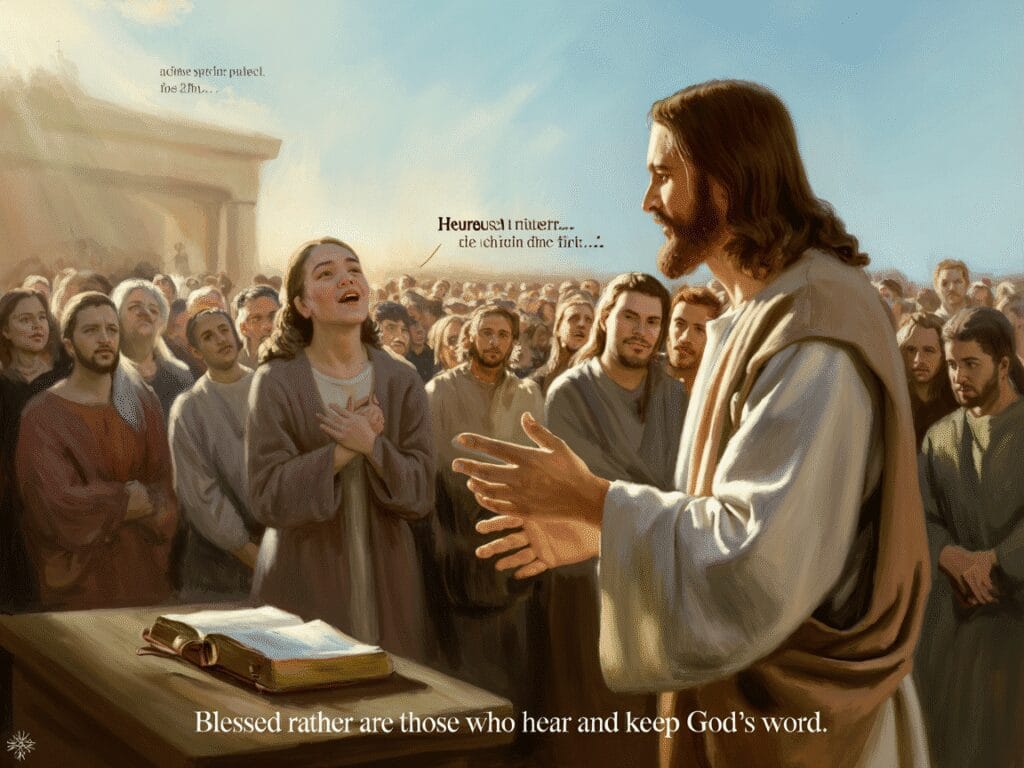
Geführte Meditation: Das Wort in uns wirken lassen
Um diesen Kommentar zu einem Gebet und einer Reise zu machen, finden Sie hier eine geführte Meditation in mehreren Phasen:
- Anfängliche Stille (2–3 Minuten): Beruhige das Herz, bitte den Heiligen Geist, uns das Zuhören zu ermöglichen.
- Langsames Lesen des Textes (Lk 11,27-28): Lesen Sie ihn mehrmals leise und achten Sie auf die Pausen.
- Persönliche Reflexion: Welcher Satz spricht mich an? Ist es der Schrei nach Maria? Ist es die Zurechtweisung Jesu? Warum?
- Körperverankerung: Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Atmung, lassen Sie das Wort von Ihrer Stirn in Ihr Herz herabsteigen.
- Dialog mit dem Herrn: Ehrlich sagen, was wir hören und was wir nicht hören wollen; um die Gnade bitten, zuzuhören und zu bewahren.
- Konkreter Vorsatz: Wählen Sie eine konkrete Handlung, die Sie während der Woche durchführen möchten und die die gehörten Worte widerspiegelt (Besuch bei einer kranken Person, Zeit zum Bibellesen, Korrektur in einer Beziehung usw.).
- Danksagung: Danksagung für Marias Beispiel und für das empfangene Wort.
Pastorale Fragen und aktuelle Herausforderungen
Welche Lehren lassen sich daraus für die heutige Marienverehrung ziehen?
Die Marienverehrung ist ein Schatz der katholischen Kirche. Sie findet ihre Erfüllung, wenn sie zu einer tieferen Liebe zu Christus und zur Treue zu seinem Wort führt. Seelsorger müssen die Gläubigen begleiten, damit die Marienverehrung das Zuhören anregt und nicht ersetzt. Marienpredigten müssen stets Bezug zum Evangelium nehmen und praktische Anwendungsmöglichkeiten bieten.
Wie schult man Zuhörer in einer lauten Welt?
Die moderne Welt stellt immer höhere Anforderungen. Pfarrgemeinden können:
- Bieten Sie kurze Exerzitien oder Tage der Besinnung an, die sich auf das Wort Gottes konzentrieren.
- Fördern Sie Zeiten der Stille vor und nach der Messe.
- Richten Sie Bibelgruppen ein, die auch für Anfänger zugänglich sind.
- Schulen Sie liturgische Teams darin, auf eine Verkündigung und Musikalität zu achten, die das Zuhören fördert.
Jugendbildung
Junge Menschen müssen auf ansprechende und treue Weise an das Hören des Wortes herangeführt werden: durch eine verkörperte Pädagogik, konkrete Zeugnisse, missionarische Aktivitäten, bei denen das Wort in die Praxis umgesetzt wird, eine angepasste Liturgie, die aber immer der Tradition treu bleibt.
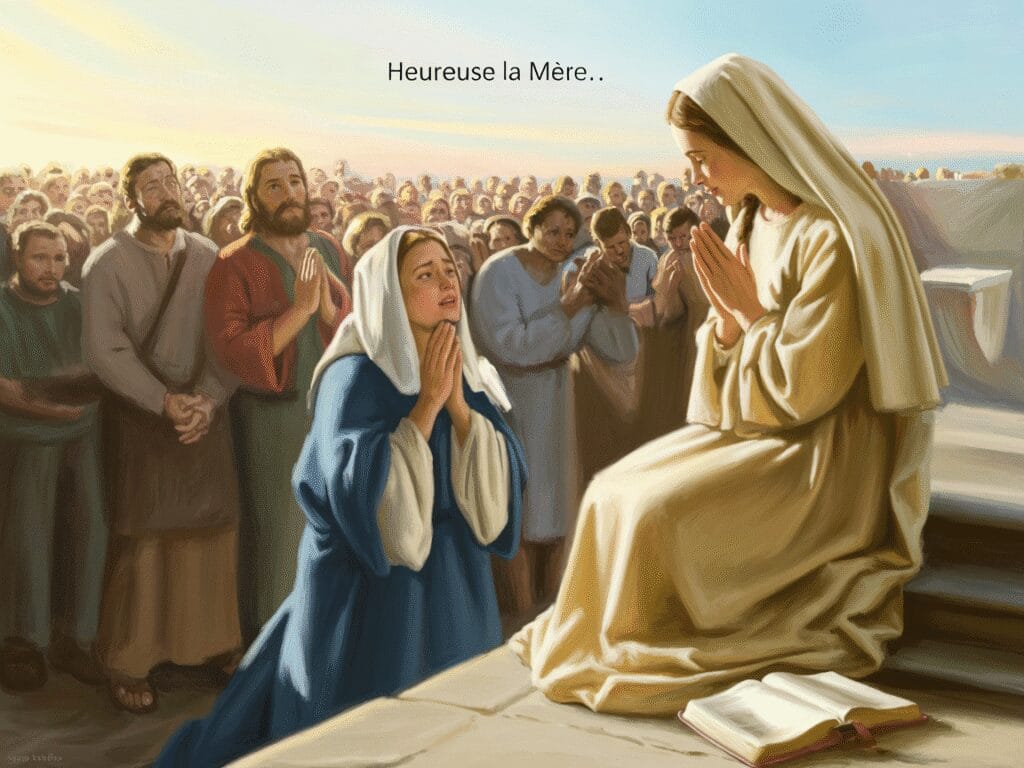
Konkrete Beispiele für die Umsetzung in den Pfarrgemeinden
- Woche des Wortes: Organisieren Sie eine Woche, in der jeden Tag eine Bibellesung vertieft wird, gefolgt von einer kleinen Austauschgruppe und einem konkreten Dienst (Lebensmittelsammlung, Besuch).
- „Sonntag des Wortes“: Verbesserung der Qualität der Verkündigung (Schulung der Vorleser), Angebot einer kurzen Katechese nach der Predigt für Erwachsene.
- „Mary Listening“-Gruppen: kleine Gemeinschaften, die Maria nachahmen, indem sie das Zuhören, die tägliche Meditation und die Bereitschaft zum Dienen pflegen.
- Ausbildung von Katecheten: Betonen Sie die Lectio divina und die praktische Anwendung, damit sie den Kindern beibringen, das Wort zu „bewahren“.
Praktische und spirituelle Schlussfolgerung
Jesus reagiert auf den Beifall der Menge und richtet die Seligpreisung neu auf das Hören und die Treue zum Wort Gottes. Diese Botschaft ist für heute: Sie fordert uns auf, das Wort Gottes nicht zu einem Schmuckstück unseres geistlichen Lebens zu machen, sondern zu seiner Quelle und seinem Maßstab. Maria bleibt unser Vorbild: Sie ist die erste und vollkommene Zuhörerin, doch ihre Mutterschaft hebt den universellen Ruf zum Hören nicht auf – sie verkörpert ihn.
Unsere Aufgabe als Jünger und als Pfarrgemeinde ist es, aufmerksame Herzen und ein konsequentes Leben zu fördern: zuzuhören, zu bewahren und zu handeln. Die Kirche bietet uns in der Liturgie, der Theologie der Väter, dem Mariengebet und den Sakramenten alle notwendigen Schätze, um diejenigen zu werden, „die das Wort Gottes hören und bewahren“. Möge unser tägliches Leben – Familie, Arbeit, soziales Engagement – das Siegel dieses lebendigen Wortes tragen: Worte, die in Gesten der Barmherzigkeit, Wahrheit und Liebe umgesetzt werden.
Kleines praktisches Blatt
- Lesen Sie jeden Tag eine kurze Passage aus dem Evangelium (5–10 Minuten) im Anschluss an die Lectio Divina: Lesen, Meditation, Gebet, Kontemplation, Entschluss.
- Machen Sie einmal pro Woche eine Gewissenserforschung, bei der Sie sich auf das Zuhören konzentrieren: Habe ich heute das Wort Gottes gehört? Habe ich es in die Tat umgesetzt?
- Nehmen Sie aktiv an der Sonntagsmesse teil, indem Sie Ihr Smartphone auf lautlos stellen und sich auf das Zuhören vorbereiten (kommen Sie 5 Minuten früher, um ein wenig Stille zu haben).
- Organisieren Sie eine Bibelstudiengruppe in Ihrer Gemeinde oder nehmen Sie daran teil: 1 Stunde pro Woche, um zu lesen, sich auszutauschen und eine konkrete Wohltätigkeitsaktion zu definieren.
- Ahmen Sie einen Monat lang Maria nach, indem Sie jeden Abend über das Magnificat meditieren und eine Gnade bemerken, die Sie durch das Zuhören erhalten haben.
Patristische und liturgische Referenzen
- Der heilige Augustinus, Predigten und Bekenntnisse: Über das Hören und Verinnerlichen des Wortes.
- Heiliger Johannes Chrysostomus, Predigten zum Lukasevangelium: Predigten über Predigt und Bekehrung.
- Ambrosius von Mailand, Über die Jungfrau Maria: Betrachtungen zu Mutterschaft und Glauben.
- Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret Dei Verbum: Vorrang des Wortes Gottes im Leben der Kirche.
- Liturgische Dokumente: Konstitution Sacrosanctum Concilium (Bedeutung des Wortes in der Liturgie).
Ein letztes Wort
Möge das Wort, das wir in der Liturgie feiern, uns jeden Tag verwandeln. Mögen wir wie Maria lernen, das Wort anzunehmen, es zu bewahren und es durch Nächstenliebe fruchtbar zu machen. Lernen wir in diesen Zeiten des großen Lärms, aufmerksame Ohren und handelnde Hände zu sein.