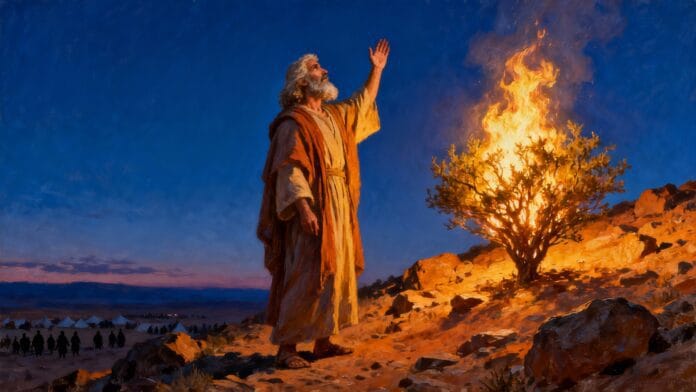Lesung aus dem Buch Exodus
Damals,
Moses hatte die Stimme des Herrn gehört
aus dem Busch.
Er antwortete Gott:
„Deshalb werde ich zu den Kindern Israels gehen und ihnen sagen:
„Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt.“
Sie werden mich fragen, wie er heißt;
Was soll ich ihnen antworten?
Gott sagte zu Moses:
„Ich bin, wer ich bin.
So sollst du zu den Kindern Israels sprechen:
„Der, der mich zu euch gesandt hat, ist ICH BIN.“
Gott sagte erneut zu Moses:
So sollst du zu den Kindern Israels reden:
„Er, der mich zu euch gesandt hat,
es ist DER HERR,
der Gott deiner Väter,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.“
Das ist für immer mein Name,
Durch ihn werdet ihr euch von Generation zu Generation an mich erinnern.
Geh hin und versammle die Ältesten Israels. Sag ihnen:
„Der Herr, der Gott eurer Väter,
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs,
erschien mir.
Er sagte mir:
Ich habe dich besucht und so gesehen
wie Sie in Ägypten behandelt werden.
Ich sagte: Ich werde dich nach oben bringen
des Elends, das dich in Ägypten überwältigt
in das Land der Kanaaniter, der Hethiter,
der Amoriter, der Perisiter, der Hewiter und der Jebusiter,
das Land, in dem Milch und Honig fließen.“
Sie werden auf Ihre Stimme hören;
dann wirst du mit den Ältesten Israels gehen,
zum König von Ägypten und sollst zu ihm sagen:
„Der Herr, der Gott der Hebräer,
kam, um uns zu finden.
Und nun lasst uns gehen
in der Wüste, drei Tage zu Fuß,
um dem Herrn, unserem Gott, ein Opfer darzubringen.“
Jetzt weiß ich, dass der König von Ägypten dich nicht gehen lassen wird
wenn er nicht dazu gezwungen wird.
Also werde ich meine Hand ausstrecken,
Ich werde Ägypten mit allen möglichen Wundern schlagen
das werde ich in ihrer Mitte vollbringen.
Danach wird er Ihnen erlauben zu gehen.“
– Wort des Herrn.
„Ich bin, wer ich bin“: Entdecken Sie den Namen, der Ihre Beziehung zu Gott verändert
Exodus 3:14 offenbart viel mehr als nur einen geheimnisvollen Namen: Es ist die Einladung, dem ewig gegenwärtigen, freien und in Ihre persönliche Geschichte eingebundenen Gott zu begegnen.
Stellen Sie sich Moses vor, barfuß vor einem brennenden Dornbusch, der sich nicht selbst verzehrt, und wagt es, Gott nach seiner Identität zu fragen. Die Antwort, die er erhält – „Ich bin, der ich bin“ – gilt seit über drei Jahrtausenden als eines der rätselhaftesten und kraftvollsten Worte der Heiligen Schrift. Dieser Vers aus Exodus 3,14 offenbart nicht nur einen göttlichen Namen unter vielen: Er öffnet ein Fenster zum Wesen Gottes, zu seinem absoluten Sein, zu seiner unveränderlichen Präsenz. Für jeden Gläubigen auf der Suche nach spiritueller Tiefe, für jeden, der verstehen möchte, wer der Gott der Bibel wirklich ist, stellt diese Offenbarung einen unerschöpflichen theologischen und existenziellen Schatz dar.
In diesem Artikel untersuchen wir zunächst den historischen und spirituellen Kontext dieser Offenbarung am brennenden Dornbusch, bevor wir den Reichtum des Gottesnamens „Ich bin“ analysieren. Anschließend werden wir drei wesentliche Dimensionen enthüllen: die absolute Transzendenz Gottes, seine befreiende Präsenz in der Menschheitsgeschichte und sein persönliches Engagement für jeden Menschen. Wir knüpfen an die große christliche spirituelle Tradition an und schlagen konkrete Wege vor, diese Offenbarung zu einer lebendigen Quelle innerer Transformation zu machen.

Kontext
Die Wüste Midian und der brennende Dornbusch
Die Episode vom brennenden Dornbusch ereignet sich an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Israels. Mose, der vierzig Jahre zuvor aus Ägypten geflohen war, nachdem er einen ägyptischen Aufseher getötet hatte, führt nun ein bescheidenes Leben als Hirte im Dienste seines Schwiegervaters Jethro, eines Priesters aus Midian. Der Text führt uns zum Berg Horeb, auch Gottesberg genannt, im Sinai. Dort, in der Einsamkeit der Wüste, findet eine der eindrucksvollsten Theophanien des Alten Testaments statt.
Die Geschichte in Exodus 3 beginnt mit einer geheimnisvollen Szene: Ein Dornbusch brennt, ohne zu verbrennen. Dieses paradoxe Bild fesselt Mose und symbolisiert bereits etwas von der göttlichen Natur: eine Macht, die sich offenbart, ohne zerstört zu werden, eine Präsenz, die wirkt, ohne sich zu erschöpfen. Als Mose näher kommt, ruft Gott seinen Namen und befiehlt ihm, seine Sandalen auszuziehen, denn der Ort ist heilig. Gewöhnliche Erde wird durch die göttliche Gegenwart zum heiligen Ort. Gott präsentiert sich zunächst als „der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs“ und stellt so die Kontinuität mit den Patriarchen und dem Ahnenbund her.
Doch bei dieser Begegnung geht es um mehr als nur die Bestätigung einer geistlichen Abstammung. Gott offenbart Mose, dass er das Elend seines Volkes in Ägypten gesehen und ihre Schreie unter den Schlägen ihrer Unterdrücker gehört hat. Er erklärt, dass er herabgekommen ist, um Israel zu befreien und es in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Mose wird dann als Werkzeug dieser Befreiung auserwählt. Angesichts dieser überwältigenden Mission stellt Mose eine naheliegende, aber weitreichende Frage: „Siehe, ich will zu den Kindern Israels gehen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Doch wenn sie mich nach seinem Namen fragen, was soll ich ihnen sagen?“
Die Offenbarung des Namens
Hier ereignet sich die zentrale Offenbarung. Gott antwortet Moses auf Hebräisch: „Ehyeh Asher Ehyeh“, was traditionell mit „Ich bin, der ich bin“ übersetzt wird. Diese rätselhafte Formel leitet sich vom hebräischen Verb „hayah“ ab, das „sein“, „existieren“, „werden“ bedeutet. Die klassische englische Übersetzung „Ich bin, der ich bin“ suggeriert absolutes Sein, Selbstexistenz und ewige Beständigkeit. Andere Übersetzungen lauten „Ich werde sein, der ich sein werde“, was die dynamische und zukünftige Dimension des Namens betont, oder „Ich bin, der ich bin“, was göttliche Selbstbestimmung ausdrückt.
Diese Mehrdeutigkeit ist keine Schwäche des Textes, sondern seine Stärke. Der offenbarte Name widersetzt sich jeder reduzierenden Definition. Gott fügt hinzu: „So sollt ihr zu den Kindern Israels sagen: ICH BIN hat mich zu euch gesandt.“ Dann fährt er fort: „Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für immer, dies ist mein Gedenkname für alle Generationen.“ Das Tetragrammaton JHWH, das in der jüdischen Tradition aus Respekt nicht ausgesprochen wird, ist somit direkt mit dieser Offenbarung des „ICH BIN“ verbunden.
Diese Offenbarung geschieht nicht in einem Tempel oder während einer feierlichen Zeremonie, sondern in der Wüste, vor einem Mann, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Sie eröffnet ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, das nicht auf einem sichtbaren und manipulierbaren Idol gründet, sondern auf einem Namen, der lebendige Präsenz und unerschütterliche Treue ausdrückt. In der katholischen Liturgie wird diese Passage bei bestimmten Feiern im Zusammenhang mit Berufung und Mission verkündet und erinnert die Gläubigen daran, dass Gott jeden Menschen beim Namen ruft und sich in der Intimität einer persönlichen Begegnung offenbart.

Analyse
Das absolute Wesen vor der Nichtigkeit der Idole
Der Leitgedanke von „Ich bin, der ich bin“ liegt in der Bekräftigung des absoluten Seins Gottes angesichts der ontologischen Nichtigkeit der Götzen. Indem Gott seinen Namen auf diese Weise offenbart, grenzt er sich radikal von allen künstlichen Gottheiten ab, die die Völker der Antike verehrten. Die ägyptischen, babylonischen oder kanaanitischen Götter trugen Namen, die mit Naturkräften, geografischen Orten oder spezifischen Funktionen verbunden waren. Der Gott Israels hingegen definiert sich durch sein Wesen selbst, durch seine reine und bedingungslose Existenz.
Diese Offenbarung enthält ein fruchtbares Paradoxon: Einerseits bekräftigt sie, dass Gott IST, absolut, ohne von irgendetwas oder irgendjemandem abhängig zu sein; andererseits weigert sie sich, Gott auf eine feste Essenz zu reduzieren, die der menschliche Verstand erfassen und in einer Definition eingrenzen könnte. „Ich bin, was ich bin“ bedeutet sowohl „Ich bin das Sein selbst, die Quelle allen Seins“ als auch „Ich bin, was ich für dich sein möchte, ich lasse mich nicht in deine Kategorien eingrenzen.“ Es ist eine Offenbarung, die zugleich gibt und stiehlt, die das Geheimnis erhellt und bewahrt.
Sowohl der heilige Augustinus als auch der heilige Thomas von Aquin haben intensiv über diesen Vers nachgedacht. Für ihn bildet Exodus 3:14 die biblische Grundlage seiner Metaphysik des Seins. Gott ist „Ipsum Esse Subsistens“, das aus sich selbst bestehende Wesen, dessen Wesen die Existenz ist. Alle Geschöpfe erhalten ihr Sein von Gott, doch Gott IST Sein. Dieser entscheidende Unterschied erklärt, warum Gott sich nicht verändert, warum er ewig und vollkommen ist: Sein Sein hängt nicht von äußeren Ursachen ab; es ist die Fülle der Existenz.
Die existenzielle Tragweite dieser Offenbarung ist immens. Sie bedeutet, dass Gott kein menschliches Konstrukt ist, keine Projektion unserer Wünsche oder Ängste. Er ist keine abstrakte Idee oder unpersönliche Kraft. Er IST, in der Fülle und Dichte seines Seins. Diese Aussage begründet das Vertrauen des Gläubigen: Wer auf „Ich bin“ vertraut, verlässt sich nicht auf Sand, sondern auf den Fels des Seins selbst. Wenn alles ins Wanken gerät, wenn menschliche Gewissheiten zusammenbrechen, wenn Projekte scheitern und Hoffnungen zerbrechen, bleibt das „Ich bin“ unerschütterlich, die Quelle aller Stabilität und aller Hoffnung.
Die Dynamik von Präsenz und Versprechen
Die Analyse des Gottesnamens kann sich nicht auf eine statische Metaphysik des Seins beschränken. Das hebräische „Ehyeh Asher Ehyeh“ lässt auch die Übersetzung „Ich werde sein, der ich sein werde“ zu und eröffnet damit eine wesentliche zeitliche und dynamische Dimension. Gott bekräftigt nicht einfach seine ewige Existenz außerhalb der Zeit; er verpflichtet sich, in der Zeit, in der konkreten Geschichte seines Volkes, gegenwärtig zu sein. Das „Ich werde sein“ drückt ein Versprechen aus: „Ich werde bei dir sein, ich werde da sein, wenn du mich brauchst, ich werde meinem Bund treu bleiben.“
Diese dynamische Lesart erhellt den gesamten Kontext der Offenbarung. Moses verlangt keine theologische Darlegung der göttlichen Natur, sondern praktische Gewissheit für seine unmögliche Mission: Wie kann er ein versklavtes Volk und einen allmächtigen Pharao überzeugen? Gottes Antwort lautet nicht: „Das bin ich in mir selbst“, sondern: „Ich bin bei dir, ich werde dich auf jedem Schritt deines Weges begleiten, du kannst auf mich zählen.“ Der göttliche Name wird so zur Garantie aktiver und befreiender Gegenwart.
Diese Dynamik des „Ich bin“ durchzieht die gesamte Heilsgeschichte. Gott begleitet Israel beim Auszug aus Ägypten, beim Durchzug durch das Rote Meer, in der Wüste und bei der Eroberung des Gelobten Landes. Jede Generation erinnert uns der im brennenden Dornbusch offenbarte Name daran, dass Gott nicht nur der ferne Schöpfer ist, der die Welt wie einen autonomen Mechanismus ins Leben rief, sondern der nahe, engagierte Gott, der eingreift, um zu retten und zu befreien. Diese Nähe hebt seine Transzendenz nicht auf: Gott bleibt der ganz Andere, der Heilige, vor dem Mose sein Gesicht verhüllt. Doch diese Transzendenz bedeutet nicht Gleichgültigkeit; im Gegenteil, sie bedeutet eine unendliche Fähigkeit zur Gegenwart und zum Handeln.
Im Neuen Testament greift Jesus diese Formel des „Ich bin“ im Johannesevangelium auf und bekräftigt wiederholt „Ego eimi“ („Ich bin“), insbesondere in Johannes 8,58: „Ehe Abraham war, bin ich.“ Diese Aussage erregt den Unmut der Pharisäer, denn sie verstehen, dass Jesus sich mit dem Gott aus Exodus 3,14 identifiziert. Das ewige „Ich bin“ wird Fleisch, er tritt in unsere Geschichte ein, er schlägt sein Zelt unter uns auf. Die Inkarnation wird so zur ultimativen Fortsetzung der Offenbarung des brennenden Dornbuschs: Gott hört nicht auf, das absolute und transzendente „Ich bin“ zu sein, aber er entscheidet sich dafür, sich auf die intimste und verletzlichste Weise zu präsentieren, die möglich ist.
Die Transzendenz, die von aller Götzenanbetung befreit
Die Offenbarung des „Ich bin, der ich bin“ bedeutet eine radikale Befreiung von Götzendienst in all seinen Formen. Im alten Ägypten, wo Moses aufwuchs, waren Götter allgegenwärtig: Ra die Sonne, Osiris der Totenkönig, Apis der heilige Stier, Horus der himmlische Falke. Jede Naturgewalt, jedes beeindruckende Tier, jedes kosmische Phänomen konnte Gegenstand der Anbetung werden. Diese Gottheiten wurden durch Statuen repräsentiert, die man sehen, berühren und herumtragen konnte. Sie vermittelten die Illusion von Kontrolle: Man brachte ihnen Opfer dar, um ihre Gunst zu erlangen, und man manipulierte sie durch magische Riten.
Der Gott, der sich Moses offenbart, durchbricht diese Logik. Indem er sich weigert, einen beschreibenden oder naturalistischen Namen zu geben, und einfach „Ich bin“ bekräftigt, entzieht er sich allen Manipulationsversuchen. Er lässt sich nicht auf eine Funktion reduzieren, in einem Tempel einsperren oder durch ein Bild darstellen. Das zweite Gebot des Dekalogs, das einige Kapitel später am Berg Sinai empfangen wurde, verbietet ausdrücklich die Herstellung göttlicher Bilder. Dieses Verbot ist nicht willkürlich: Es entspringt direkt der Natur des „Ich bin“. Wie kann man das Sein selbst darstellen? Wie kann man reine Existenz formen? Wie kann man denjenigen malen, der jenseits aller Form ist?
Diese göttliche Transzendenz befreit den Menschen von magischer Angst. In götzendienerischen Religionen lebt der Mensch in ständiger Angst, die launischen Götter zu beleidigen, einen Ritus zu verpassen oder ein Opfer zu vernachlässigen. Er wird zum Sklaven seiner eigenen religiösen Schöpfungen. Das „Ich bin“ kehrt diese Beziehung um: Der Mensch muss Gott nicht erfinden oder kontrollieren, sondern auf seine Initiative reagieren, seine Gegenwart willkommen heißen und auf seine Treue vertrauen. Religion wird zu einem Dialog mit einem persönlichen Gott und nicht zu einer Technik der Manipulation des Heiligen.
Diese Befreiung vom Götzendienst ist auch heute noch von brennender Bedeutung. Unsere modernen Götzen sind keine Statuen aus Stein oder Holz mehr, aber sie sind nicht weniger real: Geld, Macht, gesellschaftlicher Erfolg, Selbstbild, Technologie, öffentliche Meinung. Wir suchen unsere Sicherheit, unsere Identität, unseren Sinn in diesen Realitäten, die uns wie antike Götzen weder sehen noch hören noch retten können. Das „Ich bin“ aus Exodus 3,14 klingt wie ein Aufruf, die einzig wahre Quelle des Seins und des Sinns zu erkennen. Gott allein ist wahrhaftig; alles andere erhält sein Sein von ihm und vergeht ohne ihn im Nichts.
Die Tradition der Kirchenväter, insbesondere der heilige Athanasius in seinem Kampf gegen den Arianismus, entwickelte diese Theologie des göttlichen Seins. Wenn Gott „der ist, der ist“, dann hat Christus, das fleischgewordene Wort, vollen Anteil an diesem göttlichen Sein. Er ist kein noch so erhabenes Geschöpf, sondern das menschgewordene „Ich bin“ selbst. Diese Aussage schützt den christlichen Glauben vor einem Rückfall in den Polytheismus oder in eine subtile Form der Götzenanbetung, die Christus zu einem bloßen religiösen Helden machen würde. Das „Ich bin“ des brennenden Dornbuschs garantiert die Einzigartigkeit und Transzendenz Gottes und eröffnet zugleich die Möglichkeit einer wahren Inkarnation.
Die Präsenz, die begleitet und befreit
Wenn die Transzendenz des „Ich bin“ vom Götzendienst befreit, befreit seine Gegenwart von Unterdrückung. Der unmittelbare Kontext der Offenbarung des göttlichen Namens ist das Leiden Israels in Ägypten. Gott erklärt, das Elend seines Volkes gesehen, seine Schreie gehört und sein Leid gekannt zu haben. Diese dreifache Aussage – sehen, hören, wissen – drückt aktives göttliches Mitgefühl aus. Das „Ich bin“ ist kein abstraktes philosophisches Prinzip, dem das Schicksal der Menschheit gleichgültig ist, sondern ein Gott, der sich persönlich in der Geschichte engagiert, um die Unterdrückten zu befreien.
Diese befreiende Dimension des göttlichen Namens zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift. Nach der Offenbarung des brennenden Dornbusches kehrt Mose nach Ägypten zurück und stellt sich im Namen des „Ich bin“ dem Pharao entgegen. Die zehn Plagen, die über Ägypten hereinbrechen, demonstrieren die Überlegenheit des Gottes Israels über alle ägyptischen Götter. Die zehnte Plage, der Tod der Erstgeborenen, gipfelt in der Einführung des Passahfestes, einem ewigen Gedenken an die Befreiung. Die Durchquerung des Roten Meeres vollendet die Befreiung: Die Wasser, die das ägyptische Heer verschlungen haben, teilen sich, um dem Volk Gottes den Durchzug zu ermöglichen. In all diesen Ereignissen manifestiert sich die Gegenwart des „Ich bin“ als Kraft des Lebens gegen die Mächte des Todes und der Sklaverei.
Diese befreiende Gegenwart endet nicht mit dem historischen Exodus. Sie setzt sich fort in der Wolke und der Feuersäule, die Israel durch die Wüste führten, im Manna, das täglich nährte, im Wasser, das aus dem Felsen sprudelte. Das „Ich bin“ begleitet sein Volk konkret in allen Prüfungen der Reise. Wenn sich das Volk später im Gelobten Land niederlässt, wird der Tempel von Jerusalem zum symbolischen Ort dieser Gegenwart, doch die Propheten werden nie aufhören, uns daran zu erinnern, dass Gott nicht in einem steinernen Gebäude gefangen sein kann: Seine Gegenwart durchdringt alle Orte, sein Wesen erfüllt Himmel und Erde.
Diese Theologie der befreienden Gegenwart findet ihre Erfüllung in Christus. Der Name „Emmanuel“, der Jesus im Matthäusevangelium gegeben wird, bedeutet „Gott mit uns“. Das ewige „Ich bin“ wird zur fleischgewordenen Gegenwart, teilt unsere Lage, nimmt unser Leiden auf sich und stirbt unseren Tod, um uns davon zu befreien. Die Auferstehung Christi manifestiert den endgültigen Sieg des „Ich bin“ über alle Mächte der Unterdrückung und des Todes. Und das Versprechen des Auferstandenen: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ erweitert die Gegenwart des Gottes des brennenden Dornbuschs auf uns.
In unserem persönlichen spirituellen Leben befreit uns diese Präsenz des „Ich bin“ von existenzieller Einsamkeit, von dem Gefühl der Verlassenheit, von der Verzweiflung angesichts von Prüfungen. Wir sind nie allein: Derjenige, der IST, ist bei uns, in uns, für uns. Diese Gewissheit befreit uns nicht von Anstrengungen oder Kämpfen, sondern schenkt uns unerschöpfliche innere Kraft. Die heilige Teresa von Avila drückte dieses Bewusstsein der göttlichen Gegenwart so großartig aus: „Gott allein ist genug.“ Wenn wir das „Ich bin“ besitzen, wenn wir von ihm besessen sind, kann uns nichts wirklich fehlen oder uns zerstören.
Das persönliche Engagement, das die Allianz begründet
Die dritte Achse des Verständnisses „Ich bin, der ich bin“ betrifft Gottes persönliches Engagement für eine Bundesbeziehung. Der Name, der am brennenden Dornbusch offenbart wurde, ist keine neutrale Information über die göttliche Natur, sondern der Beginn einer Beziehung. Gott sagt nicht einfach: „Das bin ich“, sondern: „Das bin ich für dich, das werde ich mit dir sein.“ Der Theologe Bruce Waltke fasst diese Dimension treffend zusammen: „Ich bin, der ich für dich bin.“ Der göttliche Name drückt eine auf uns ausgerichtete Präsenz aus, ein Für-den-anderen-sein, das Gottes Liebe ausmacht.
Diese Personalisierung des göttlichen Namens manifestiert sich unmittelbar nach der Offenbarung. Gott sagt nicht einfach „Ich bin“, sondern fügt hinzu: „der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.“ Er definiert sich über seine Beziehungen, über die Bündnisse, die er mit den Patriarchen schloss, über die Geschichte, die er mit ihnen teilte. Diese relationale Definition ergänzt die ontologische. Gott ist das absolute Wesen, aber dieses absolute Wesen entscheidet sich dafür, Beziehungen einzugehen, sich durch Versprechen zu binden und eine gemeinsame Geschichte mit konkreten Menschen zu führen.
Der Bund, der wenige Wochen nach der Offenbarung des brennenden Dornbusches am Berg Sinai geschlossen wurde, besiegelte diese gegenseitige Verpflichtung. Gott bot seinen Schutz, seine Gegenwart und sein Lebensgesetz an; das Volk verpflichtete sich, nur ihn anzubeten und seinen Geboten zu folgen. Dieser Bund war kein Handelsvertrag zwischen gleichberechtigten Partnern, sondern ein Treuepakt, in dem Gott die Initiative ergriff und der Mensch frei reagierte. Aus dem „Ich bin“ wurde „Ich bin dein Gott“, und Israel antwortete: „Du bist unser Gott.“ Diese Gegenseitigkeit begründete die Identität Israels und, im weiteren Sinne, die Identität jedes Gläubigen.
Die persönliche Hingabe des „Ich bin“ gipfelt in der Menschwerdung und im Kreuz. Der heilige Johannes bekräftigt in seinem Prolog, dass das Wort „bei Gott war und Gott das Wort war“, und spricht damit die Sprache des absoluten Seins. Doch dieses Wort „wurde Fleisch und wohnte unter uns“. Das göttliche Wesen engagiert sich bis zur Menschwerdung, bis hin zum Leiden und Sterben aus Liebe. Das Kreuz offenbart die unergründliche Tiefe der Hingabe des „Ich bin“: Gott ist nicht nur in guten Zeiten bei uns, er ist bei uns im Abgrund von Leid und Tod. Er verwandelt diese Wirklichkeiten von innen heraus in Wege des Lebens und der Auferstehung.
Für unser Glaubensleben verändert diese relationale Dimension des „Ich bin“ alles. Gott ist kein philosophisches Prinzip, das man aus der Ferne betrachtet, sondern eine lebendige Person, die man liebt und zu der man spricht. Das Gebet wird zum Dialog mit dem „Ich bin“, nicht zu einem qualvollen Monolog angesichts der Leere. Der Gehorsam gegenüber den Geboten wird zu einer liebevollen Antwort an den, der uns zuerst geliebt hat. Die Sakramente werden zu realen Begegnungen mit der Gegenwart des „Ich bin“ in unserem Fleisch und unserer Geschichte. Unsere ganze Existenz kann sich unter dem gütigen Blick dessen entfalten, der uns beim Namen ruft und sagt: „Ich bin bei dir.“

Tradition
Die Kirchenväter und die Metaphysik des Exodus
Die patristische Tradition hat Exodus 3:14 zu einer Säule der christlichen Theologie gemacht. Der heilige Augustinus meditiert in seinen Hauptwerken wie „Vom Gottesstaat“ und „Die Bekenntnisse“ ausführlich über das „Ich bin, der ich bin“. Für ihn offenbart dieser Vers, dass Gott das unveränderliche Wesen schlechthin ist, das keiner Veränderung, keiner Veränderung und keiner Verderbnis unterliegt. Alles, was in der Zeit existiert, unterliegt der Veränderung und hat daher insofern am Nichts teil, als es vom Nichtsein zum Sein übergeht und dann wieder zum Nichtsein zurückkehrt. Nur Gott IST wahrhaftig, in einer ewigen Beständigkeit, die die Zeit übersteigt.
Diese augustinische Meditation begründet eine „apophatische Theologie“, d. h. eine Theologie, die die Unfähigkeit der menschlichen Sprache anerkennt, das göttliche Mysterium vollständig zu erfassen. Augustinus behauptet, dass wir zwar sagen können, was Gott nicht ist – er ist nicht sterblich, nicht veränderlich, nicht zusammengesetzt, nicht begrenzt –, aber niemals angemessen sagen können, was er IST. Das „Ich bin“ bleibt immer jenseits unserer Konzepte, unserer Bilder, unserer Formulierungen. Diese intellektuelle Demut schützt den Glauben vor der Gefahr geistiger Vergötterung, die darin bestehen würde, unsere Vorstellungen von Gott mit Gott selbst zu verwechseln.
Der heilige Thomas von Aquin systematisierte diese Überlegungen im 13. Jahrhundert in seiner „Summa Theologica“. Er widmete dem göttlichen Namen und dem Wesen Gottes mehrere Fragen. Für Thomas offenbart Exodus 3:14, dass das Wesen Gottes die Existenz ist. In jedem Geschöpf kann man zwischen Wesen (was es ist) und Existenz (die Tatsache, dass es ist) unterscheiden; nur in Gott fallen Wesen und Existenz vollkommen zusammen. Gott erhält seine Existenz nicht von einer externen Quelle; er IST die Existenz selbst und existiert aus sich selbst heraus. Aus dieser grundlegenden Intuition leitet Thomas alle göttlichen Eigenschaften ab: Einfachheit, Vollkommenheit, Unendlichkeit, Unveränderlichkeit, Ewigkeit, Einheit.
Diese „Metaphysik des Exodus“, wie Étienne Gilson es formulierte, hat die westliche Theologie tiefgreifend beeinflusst. Sie legt fest, dass die christliche Philosophie nicht gegen die biblische Offenbarung, sondern aus ihr heraus aufgebaut ist. Die vom Glauben erleuchtete menschliche Vernunft kann über das „Ich bin“ meditieren und seine metaphysischen Implikationen entfalten, ohne das offenbarte Mysterium zu verraten. Diese Harmonie zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Offenbarung und Philosophie kennzeichnet die große katholische Tradition und unterscheidet das Christentum von einem Fideismus, der die Intelligenz verachtet, oder von einem Rationalismus, der das Mysterium ergründen will.
Die Mystik des Namens in der christlichen Spiritualität
Jenseits der spekulativen Theologie hat das „Ich bin“ eine reiche mystische und spirituelle Tradition hervorgebracht. Die Philokalia, eine Sammlung spiritueller Texte aus dem christlichen Osten, lehrt das „Jesusgebet“ oder „Herzensgebet“: „Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner Sünder.“ Dieses unaufhörliche Gebet, das im Einklang mit der Atmung wiederholt wird, zielt darauf ab, das Bewusstsein in der Gegenwart des in Jesus Fleisch gewordenen „Ich bin“ zu verankern. Es verwandelt den Betenden allmählich, reinigt sein Herz und vereint ihn mit Christus.
Die heilige Katharina von Siena spricht in ihren mystischen Schriften immer wieder von Gott als dem, der ist, im Gegensatz zu sich selbst, die nur diejenige ist, die nicht ist. Dieses tiefe Bewusstsein des ontologischen Missverhältnisses zwischen Gott und Geschöpf löst keine Verzweiflung, sondern Staunen aus. Wenn Gott, der ganz und gar ist, sich demjenigen zuneigt, der nichts ist, geschieht dies aus reiner, unentgeltlicher Liebe. Diese mystische Demut öffnet den Menschen für die Erfahrung göttlicher Liebe in ihrer radikalsten Unentgeltlichkeit.
Die großen spanischen Karmeliter des 16. Jahrhunderts, der heilige Johannes vom Kreuz und die heilige Teresa von Avila, entwickelten eine Spiritualität der Vereinigung mit Gott, die das Ablegen aller Bilder, aller Konzepte und aller sinnlichen Tröstungen voraussetzt. Um sich mit dem „Ich bin“ zu vereinen, muss man bereit sein, die „dunkle Nacht“ zu durchschreiten, jenes innere Fegefeuer, in dem Gott abwesend scheint, in Wirklichkeit aber in den Tiefen der Seele wirkt. Die höchste mystische Erfahrung, die Johannes vom Kreuz „geistige Ehe“ nennt, ist die Teilhabe am Wesen Gottes, eine so innige Gemeinschaft, dass die Seele mit dem heiligen Paulus sagen kann: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Das göttliche „Ich bin“ wird der Seele mitgeteilt, die durch die Gnade Teilhabe an der göttlichen Natur erlangt.
Diese mystische Tradition ist nicht einer Elite kontemplativer Menschen vorbehalten, die sich von der Welt zurückgezogen haben. Sie ruft jeden Getauften dazu auf, ein tiefes Innenleben zu pflegen, die Gegenwart des „Ich bin“ in Stille und Gebet zu suchen und sich nicht mit einem oberflächlichen oder rein intellektuellen Glauben zufrieden zu geben. Die Sakramente, insbesondere die Eucharistie, sind die bevorzugten Orte, an denen sich uns das „Ich bin“ unter der Gestalt von Brot und Wein schenkt. Die Messe wird so zum täglichen brennenden Dornbusch, in dem Christus, die reale Gegenwart des „Ich bin“, sich offenbart und uns als Nahrung schenkt.

MeditationS
Wie können wir die Offenbarung aus Exodus 3:14 nicht nur zum Gegenstand theologischer Studien machen, sondern zu einer Quelle spiritueller Transformation? Hier sind sieben konkrete Schritte, um die „Ich bin“-Botschaft in Ihrem täglichen Leben zu verkörpern.
Erster Schritt Beginnen Sie jeden Tag mit einem Moment der Stille, in dem Sie sich der Gegenwart des „Ich bin“ bewusst werden. Bevor Sie mit Ihren Aktivitäten beginnen, setzen Sie sich ruhig hin, schließen Sie die Augen und wiederholen Sie sich: „Ich bin bei dir.“ Lassen Sie dieses göttliche Wort in Ihrem Herzen wohnen. Heißen Sie die Gegenwart Gottes nicht als abstrakte Idee willkommen, sondern als lebendige Realität, die Sie umgibt und durchdringt. Fünf Minuten genügen, um Ihren Tag in diesem grundlegenden Bewusstsein zu verankern.
Zweiter Schritt Identifizieren Sie Ihre persönlichen Idole. Was ersetzt in Ihrem Leben das „Ich bin“? Geld, die Wahrnehmung anderer, beruflicher Erfolg, Gesundheit, Familie? All diese Realitäten sind an sich gut, werden aber zu Idolen, wenn wir ihnen die Macht geben, unsere Identität und unseren Wert zu definieren. Schreiben Sie eine Liste Ihrer potenziellen Idole und bitten Sie dann das „Ich bin“ um die Gnade, diese Bindungen zu relativieren und Ihre ultimative Sicherheit allein darin zu finden.
Dritter Schritt Übe Lectio Divina zu Exodus 3,1-15. Lies den Text vom brennenden Dornbusch langsam und lass ihn in dir nachklingen. Versetze dich in Moses‘ Lage und höre, wie Gott dich beim Namen ruft. Was sagt dir das „Ich bin“ heute? Auf welche Mission schickt er dich? Was sind deine Ängste und Einwände, wie Moses? Führe den Dialog mit Gott im Gebet, ganz offen und einfach. Achte auf die Erkenntnisse, die sich aus dieser Meditation ergeben.
Vierter Schritt : In Zeiten der Prüfung oder Angst verankern Sie sich im „Ich bin“. Wenn Sie sich von den Umständen überwältigt fühlen, wenn Sie sich Sorgen um die Zukunft machen, wenn Sie an sich selbst zweifeln, wiederholen Sie für sich selbst oder leise: „Ich bin, der ich bin.“ Diese Bestätigung ist kein magisches Mantra, sondern ein Akt des Glaubens: Sie erkennen, dass Gott IST, dass er stabil bleibt, wenn alles andere wankt, dass er Ihr Fels und Ihre Festung ist. Diese einfache, aber wirkungsvolle Übung kann Ihre Beziehung zur Angst verändern.
Fünfter Schritt Engagieren Sie sich konkret für die Befreiung. Das „Ich bin“ offenbarte sich Moses, um ein unterdrücktes Volk zu befreien. Es setzt sich auch heute noch für die Befreiung von allen Formen der Sklaverei ein. Wählen Sie eine Sache, wo Ungerechtigkeit zum Himmel schreit: Obdachlose, Migranten, Opfer von Gewalt, Arme, isolierte Kranke. Geben Sie Ihre Zeit, Ihre Fähigkeiten, Ihre Ressourcen. Indem Sie ein Instrument der Befreiung für andere werden, nehmen Sie an der Mission des „Ich bin“ teil.
Sechster Schritt : Pflegen Sie eine tiefe Eucharistiepraxis. Wenn Sie katholisch sind, gehen Sie mit dem erneuerten Bewusstsein zur Eucharistie, dass Christus, der Mensch gewordene „Ich bin“, sich Ihnen wirklich hingibt. Öffnen Sie vor der Kommunion Ihr Herz, um den zu empfangen, der ist. Verweilen Sie nach der Kommunion in stiller Dankbarkeit und lassen Sie zu, dass die Gegenwart des „Ich bin“ Sie von innen heraus verwandelt. Wenn Sie die sakramentale Kommunion nicht empfangen können, praktizieren Sie die geistige Kommunion und bitten Sie Christus, in Sie zu kommen und in Ihnen zu wohnen.
Siebter Schritt Beenden Sie jeden Tag mit einer Gewissenserforschung, die sich auf die Gegenwart des „Ich bin“ konzentriert. Betrachten Sie Ihren Tag nicht primär aus moralischer Perspektive (was habe ich gut oder schlecht gemacht?), sondern aus der Perspektive der Gegenwart: Wo habe ich heute das „Ich bin“ erkannt? Bei welchen Menschen, in welchen Situationen, bei welchen Ereignissen? Wo habe ich es nicht erkannt? Wo habe ich es ignoriert oder abgelehnt? Danke Gott für seine treue Gegenwart, bitte ihn um Vergebung für deine Blindheit, erneuere deinen Wunsch, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Dann begib dich für die Nacht in seine Hände.
Abschluss
Die Offenbarung in Exodus 3,14 – „Ich bin, der ich bin“ – ist einer der Höhepunkte der Heiligen Schrift und der Theologie. Sie offenbart uns einen Gott, der alle unsere Kategorien unendlich übersteigt, der in der absoluten Fülle des Seins IST und allen Manipulationsversuchen und Götzendiensten entgeht. Gleichzeitig offenbart sich dieser unendlich transzendente Gott als unendlich nah, in unsere Geschichte eingebunden, in unseren Kämpfen präsent und seinen Versprechen treu. Das „Ich bin“ ist keine philosophische Abstraktion, sondern eine lebendige Person, die uns liebt, ruft und sendet.
Diese Offenbarung besitzt eine revolutionäre, transformierende Kraft. Sie befreit uns von Existenzängsten, indem sie uns im Wesen Gottes verankert. Sie befreit uns vom Götzendienst, indem sie uns von allen falschen Sicherheiten löst und uns mit der einzig wahren Quelle des Lebens verbindet. Sie befreit uns von Einsamkeit, indem sie uns eine bedingungslose und unveränderliche Gegenwart zusichert. Sie verpflichtet uns zu einer Mission der Befreiung aller Unterdrückten, wie Gott, der den Schrei der Sklaven in Ägypten erhörte.
Aus dem „Ich bin“ zu leben bedeutet, eine radikale Veränderung unserer Sicht auf Gott, uns selbst und die Welt zu akzeptieren. Es bedeutet, der Illusion absoluter Autonomie zu entsagen und uns als Geschöpfe zu erkennen, die völlig von dem abhängig sind, der ist. Es bedeutet, die ängstliche Suche nach Sinn und Sicherheit in vergänglichen Dingen aufzugeben und allein auf Gott zu vertrauen. Es bedeutet, Zeugen und Werkzeuge seiner befreienden Gegenwart in einer Welt zu werden, die nach Absolutem dürstet und nach Sinn hungert.
Der letzte Ruf aus Exodus 3,14 berührt uns heute alle. Wie Moses in der Wüste sind wir eingeladen, die Sandalen auszuziehen, denn der Ort, an dem wir stehen – hier und jetzt – kann durch die Gegenwart des „Ich bin“ zu heiligem Boden werden. Wir sind aufgerufen, nicht der Welt zu entfliehen, sondern den lebendigen Gott in ihr zu erkennen und ihm zu dienen. Mögen wir Tag für Tag lernen, in dem wunderbaren Bewusstsein zu leben, dass das ewige „Ich bin“ mit uns, in uns und für uns ist. Aus diesem Bewusstsein werden innerer Frieden, Nächstenliebe und der Mut zur Mission erwachen. Denn der, der uns sendet, hat gesagt: „Ich bin mit euch.“
Praktisch
- Tägliche Morgenmeditation : Verbringen Sie jeden Morgen fünf Minuten damit, die Gegenwart des „Ich bin“ in Stille willkommen zu heißen, bevor Sie etwas unternehmen oder sich ablenken lassen.
- Identifikation und Entgötterung : Listen Sie Ihre persönlichen Idole auf und bitten Sie um die Gnade, Ihre ultimative Sicherheit allein in Gott, die Quelle allen Seins, zu setzen.
- Wöchentliche Lectio Divina : Meditieren Sie einmal pro Woche über Exodus 3:1-15 und stellen Sie sich vor, dass Gott Sie persönlich ruft und Ihnen seinen Namen offenbart.
- Verankerung im Test : Wenn Sie von Angst oder Zweifeln befallen werden, wiederholen Sie innerlich „Ich bin, der ich bin“ als Akt des Glaubens an die göttliche Beständigkeit.
- Konkretes Solidaritätsengagement : Wählen Sie ein Werk zur Befreiung der Unterdrückten, in das Sie regelmäßig investieren und so an der Mission des befreienden „Ich bin“ teilnehmen.
- Eucharistische Vertiefung : Gehen Sie mit dem erneuerten Bewusstsein an die Eucharistie heran, dass Christus, der Mensch gewordene „Ich bin“, sich Ihnen wahrhaftig unter der Gestalt des Brotes hingibt.
- Abendliche Präsenzprüfung : Lassen Sie jeden Abend Ihren Tag Revue passieren und stellen Sie fest, wo Sie die Präsenz des „Ich bin“ wahrgenommen und wo Sie sie ignoriert haben. Schließen Sie mit einem Dank ab.
Verweise
- Bibeltext : Exodus 3:1-15, insbesondere Vers 14 in den verschiedenen französischen Übersetzungen (Jerusalemer Bibel, TOB, New Segond Bible).
- Patristisch : Heiliger Augustinus, Von Trinitate Und Die Stadt Gottes, für die Theologie des unveränderlichen und ewigen Wesens Gottes.
- Mittelalterliche Theologie : Heiliger Thomas von Aquin, Summa Theologica I, Fragen 2-13, zur Existenz und Natur Gottes aus Exodus 3:14.
- Mystische Spiritualität : Heilige Katharina von Siena, Der Dialog, über den Kontrast zwischen „Er, der ist“ und „sie, die nicht ist“.
- Östliche Tradition : Philokalia, eine Zusammenstellung von Texten zum Herzensgebet und dem ständigen Bewusstsein der göttlichen Gegenwart.
- Karmelitischer Mystiker : Heiliger Johannes vom Kreuz, Der Aufstieg zum Karmel Und Die dunkle Nacht, auf die verwandelnde Vereinigung mit dem „Ich bin“.
- Zeitgenössische Exegese : Bruce Waltke und andere Bibelkommentatoren zur relationalen Bedeutung des göttlichen Namens: „Für dich bin ich, wer ich bin.“
- Christliche Philosophie : Etienne Gilson, Der Geist der mittelalterlichen Philosophie, über die „Metaphysik des Exodus“ und den Einfluss von Exodus 3:14 auf das westliche Denken.