Evangelium nach dem Johannes
Damals,
Jesus sagte zu den Menschenmengen:
«Alle, die mir der Vater gibt
wird zu mir kommen;
und wer zu mir kommt,
Ich werde ihn nicht rauswerfen.
Denn ich bin vom Himmel herabgestiegen
meinen Willen nicht zu tun,
sondern der Wille dessen, der mich gesandt hat.
Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat:
damit ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat,
aber dass ich sie am Jüngsten Tag auferwecken werde.
Dies ist der Wille meines Vaters:
dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt
ewiges Leben haben;
Und ich werde ihn am Jüngsten Tag auferwecken.»
– Lasst uns das Wort Gottes bejubeln.
Um ins Leben einzutreten, muss man glauben: die Verheißung des auferstandenen Christus annehmen.
Wie der Glaube an Jesus Christus unser Verhältnis zum Tod, unser Vertrauen und die konkrete Hoffnung auf den Jüngsten Tag verändert.
In dieser Passage aus dem Johannesevangelium (6,37–40) gibt Jesus ein Versprechen, das jeglicher menschlichen Logik widerspricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht verlassen, sondern zum ewigen Leben auferweckt werden. Diese Worte, die auch im Halleluja-Ruf (Johannes 11,25–26) zu finden sind, sprechen alle Generationen an, die mit der Sterblichkeit ringen. Dieser Artikel richtet sich an alle, die verstehen möchten, was es im christlichen Glauben bedeutet, «am Jüngsten Tag aufzuerstehen» und wie man dieses ewige Leben, das Christus verkündet, schon hier auf Erden leben kann.
- Evangeliumskontext: die Offenbarung eines Gottes, der die Menschen zu sich zieht.
- Analyse der Textstelle: vom Willen des Vaters bis zur verheißenen Auferstehung.
- Drei Themenbereiche: Vertrauen, Transformation, Hoffnung.
- Praktische Anwendungen im spirituellen und alltäglichen Leben.
- Sie erinnert an christliche Tradition und Liturgie.
- Meditative Praxis und Reaktion auf aktuelle Herausforderungen.
- Schlussgebet und spiritueller Leitfaden.

Kontext
Das Johannesevangelium, das die Offenbarung Christi stärker in den Mittelpunkt stellt als die Schilderung von Ereignissen, möchte den Leser in das Geheimnis dessen einführen, den es das fleischgewordene Wort nennt. Die hier betrachtete Passage ist Teil der Rede vom Brot des Lebens (Johannes 6), die nach der Speisung der Fünftausend gehalten wurde. Die Menschenmenge, fasziniert, aber oft auf ein rein materielles Verständnis des Wunders beschränkt, hört Jesus vom Brot des Himmels sprechen, einer Gabe des Vaters, der Speise für das ewige Leben.
Inmitten dieser Spannungen und Missverständnisse erklingt diese Botschaft der Autorität und Zärtlichkeit: Alle, die der Vater dem Sohn gibt, werden zu ihm kommen; und wer kommt, den wird Jesus nicht abweisen. Es geht hier also nicht um selektive Auswahl oder spirituelle Privilegien, sondern um eine Offenbarung: Ewiges Leben entspringt der innigen Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und jedem einzelnen Gläubigen.
Aus theologischer Sicht lassen sich in diesem Text drei Ebenen unterscheiden:
– die Mission des Sohnes, die dem Plan des Vaters vollkommen gehorcht;
– göttliche Treue, die keinen derer verliert, die sie liebt;
– und schließlich das Versprechen der Auferstehung, ein Zeichen dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
Die Wiederholung dieser Verheißung in Johannes 11, während der Begegnung mit Martha und Maria am Grab des Lazarus, unterstreicht die Aussagekraft der Botschaft: «Ich bin die Auferstehung und das Leben.» Diese Passage ist somit keine Theorie über das Jenseits, sondern eine Einladung zur inneren Wandlung im Hier und Jetzt. An den Sohn zu glauben bedeutet bereits, an der Dynamik der Auferstehung teilzuhaben.
Analyse
Der zentrale Gedanke dieser Passage beruht auf Gottes Willen zur universellen Erlösung: Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Indem Christus zustimmte, vom Himmel herabzusteigen, um den Willen des Vaters zu erfüllen, bewies er doppelte Treue: gegenüber seiner Mission und gegenüber der ihm anvertrauten Menschheit. Der Ausdruck «Ich werde ihn nicht verstoßen» beseitigt die Furcht vor Ablehnung und symbolisiert Gottes offenes Herz.
Auf spiritueller Ebene ist die Verheißung der Auferstehung kein Ausweg, sondern die Gewissheit, dass alles, was Gott anvertraut ist, in ihm bleibt. Jesus verbindet den Akt des Glaubens eng mit der Erfahrung des Lebens: «Wer glaubt», lebt bereits in Ewigkeit, denn der Glaube führt den Gläubigen in die lebendige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn.
Dieser Text offenbart auch eine Logik freudiger Abhängigkeit: Glauben ist keine einsame Anstrengung, sondern die Antwort auf einen Ruf. Der Gläubige rettet sich nicht aus eigener Kraft, sondern wird getragen. Der Wille des Vaters und die Treue des Sohnes bilden das Fundament eines Vertrauens, das selbst im Angesicht des Todes nicht wankt.
Das Vertrauen, das das Herz öffnet
Der erste Teil dieses Textes ist ein Teil des Vertrauens. Indem Jesus erklärt, dass er niemanden zurückweist, stellt er das durch die ursprüngliche Angst – die Angst vor dem Verlassenwerden – zerbrochene Band wieder her. Die Erfahrung des Glaubens wird so zu einem Lernen der Zustimmung. Sich dem Sohn hinzugeben bedeutet, die Kontrolle über das eigene Schicksal abzugeben und sich von einer Liebe, die stärker ist als der Tod, aufnehmen zu lassen. Deshalb ist der christliche Glaube keine Idee, sondern eine vertrauensvolle Hingabe.
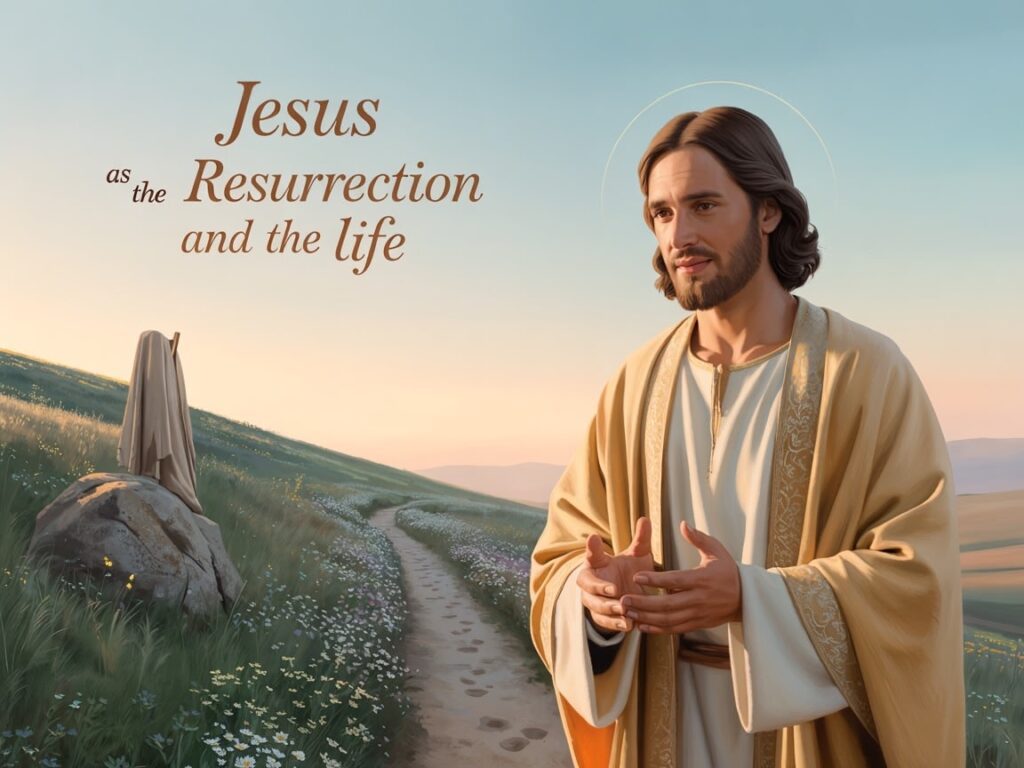
Die innere Transformation
Die Verheißung «Wer glaubt, hat das ewige Leben» lädt uns ein zu verstehen, dass dieses Leben im Hier und Jetzt beginnt. Die Auferstehung ist nicht in erster Linie ein zukünftiges Ereignis, sondern ein Prozess innerer Wandlung: ein Übergang von der Angst zur Freude, von der Einsamkeit zur Gemeinschaft. Diese Wandlung findet ihren Ausdruck in der Teilnahme an der Eucharistie, wo der Gläubige das vom Himmel herabgekommene Brot empfängt. In jeder Feier hört er die Worte: «Nehmt und esst, das ist mein Leib.» Hier wird die Verbindung zwischen Glaube und ewigem Leben geknüpft: Das Wort und das Brot werden zur Nahrung für das auferstandene Herz.
Hoffentlich sieht es bis zum letzten Tag so aus.
Letztlich lenkt die Verheißung des «Jüngsten Tages» das Leben des Gläubigen auf eine eschatologische Perspektive. Dieser Jüngste Tag ist weder eine Drohung noch ein ungewisser Termin: Er ist die Fülle der Begegnung. Christliche Hoffnung besteht nicht darin, dieser Welt zu entfliehen, sondern darin, im Sichtbaren den Keim des Unsichtbaren zu erkennen. Deshalb wiederholt die Liturgie für die Verstorbenen die Worte: «Und ich werde ihn von den Toten auferwecken.» Jede Beerdigung wird so zu einem Bekenntnis des Vertrauens. An diese Verheißung zu glauben bedeutet bereits, im Angesicht Gottes auferstanden zu sein.
Anwendungen
Im Alltag: lernen, das Leben als Geschenk anzunehmen. Wer an Jesus glaubt, definiert sich nicht länger über Angst oder Erfolg, sondern über die Beziehung zu ihm. In Zeiten der Prüfung befreit diese Botschaft von der Verzweiflung: Nichts, nicht einmal der Tod, kann uns von der Liebe des Sohnes trennen.
Im familiären Umfeld: Dieses Versprechen lindert Trauer und stärkt die Treue. Es lehrt uns, furchtlos über den Tod zu sprechen und die christliche Hoffnung weiterzugeben.
Im Leben der Kirche unterstützt sie die Mission jeder Gemeinde – einen Gott bekannt zu machen, der niemanden ablehnt. Jede Taufe, jede Eucharistie ist eine Verkündigung dieser Treue des Vaters.
In der Gesellschaft lädt es uns ein, zerbrochene menschliche Situationen als Quelle der Erneuerung zu sehen: Ausgrenzung, Gewalt, Verlust. Der Blick des Sohnes erweckt in jedem Menschen die ewige Würde.

Traditionelle Resonanzen
Von den Kirchenvätern bis heute hat diese Passage die Meditation über Barmherzigkeit und ewiges Leben genährt. Der heilige Irenäus erkannte im Willen des Vaters den Plan, «alles in Christus zusammenzufassen». Der heilige Augustinus betonte den Glauben als einen Akt der Schau: «Den Sohn zu sehen» ist kein physisches Sehen, sondern die Öffnung des Herzens für die Gegenwart Gottes.
Die Liturgie Allerheiligen und Allerheiligen hat diese Verheißung zum zentralen Thema. Sie gründet das christliche Gebet in der Überzeugung, dass jedes Glied des Leibes Christi am Sieg über den Tod teilhat. Der Katechismus der Katholischen Kirche (Nr. 1002–1004) präzisiert, dass die Auferstehung mit dem Leben der Gnade beginnt: Die Taufe nimmt uns bereits in das ewige Leben auf.
Letztlich hat die klösterliche Tradition dieses Sprichwort oft als Aufruf zur inneren Wachsamkeit interpretiert. Der Mönch lebt jeden Tag «als stünde er an der Schwelle der Auferstehung» und hält sein Herz wach für die Gegenwart des Sohnes, der ihn zu sich zieht.
Meditationstrack
- Sitze in Stille, atme langsam.
- Lies den Satz langsam: «Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben.».
- Sich an eine Situation zu erinnern, in der man sich abgelehnt fühlte, und sie Christus anzuvertrauen.
- Stell dir das Antlitz des Herrn vor, der ohne zu urteilen willkommen heißt.
- Bitte um die Gnade, daran zu glauben, dass nichts verloren ist.
- Es endet in Stille, wobei sie wiederholen: «Und ich werde ihn am Jüngsten Tag auferwecken.»
Dieses kurze, innere Gebet, regelmäßig wiederholt, wird in Momenten der Unsicherheit zu einem Anker der Zuversicht. Die Auferstehung ist dann nicht länger nur eine zukünftige Perspektive, sondern eine verwandelte Gegenwart.
Aktuelle Herausforderungen
Wie können wir in einer säkularisierten Welt von der Auferstehung sprechen? Die Herausforderung besteht darin, dieses Versprechen hörbar zu machen, ohne es auf eine bloße Metapher zu reduzieren. Der christliche Glaube leugnet nicht die biologische Realität des Todes; er verkündet, dass ihn eine stärkere Liebe durchdringt. Angesichts von Leid oder kollektiven Tragödien wird diese Überzeugung zu einem Akt spirituellen Widerstands.
Eine weitere Herausforderung: das ewige Leben zu verstehen, ohne es dem irdischen Leben gegenüberzustellen. Der Gläubige ist kein Flüchtling vor der Welt, sondern ein Zeuge ihrer Verwandlung. Die christliche Mission besteht darin, jede Begegnung zu einem Ort der Auferstehung zu machen.
Angesichts der Versuchung der heutigen Verzweiflung erinnert uns der Glaube an die Auferstehung daran, dass alles Dasein zur Schönheit berufen ist. Papst Franziskus drückt dies so aus: «Christliche Hoffnung ist Kühnheit.» Sie leugnet die Wunden der Welt nicht, sondern sät in sie hinein die Verheißung des Jüngsten Tages.
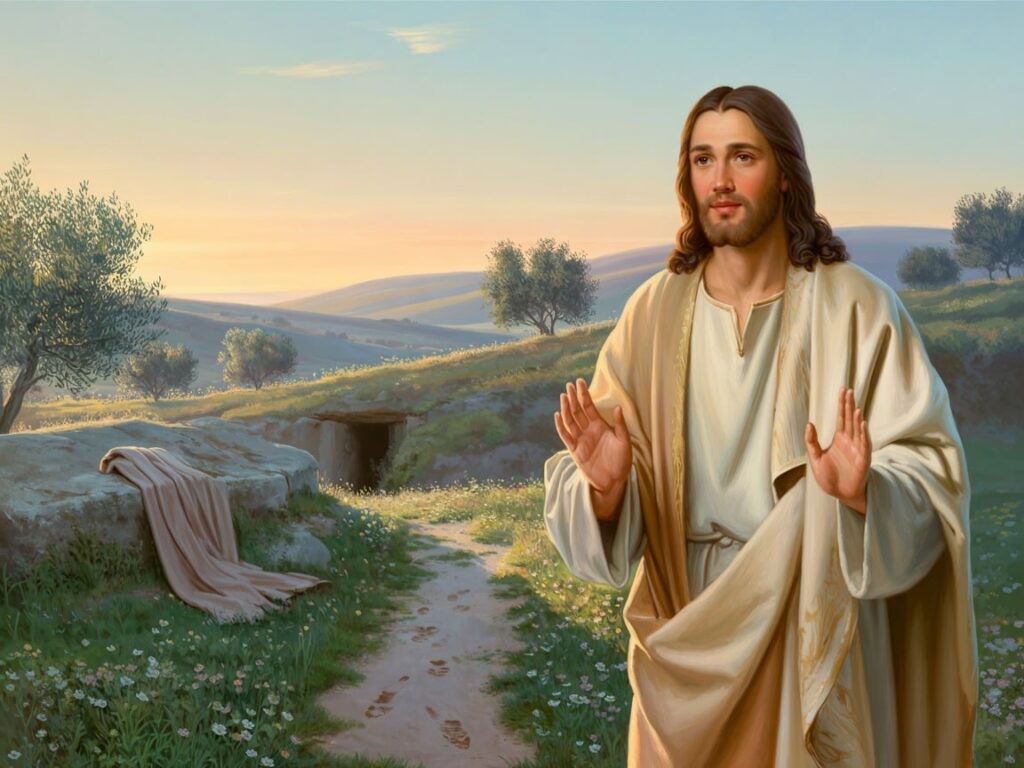
Gebet
Herr Jesus,
Du, der du vom Himmel herabgestiegen bist, um den Willen des Vaters zu erfüllen,
Nimm diejenigen an, die du zum ewigen Leben rufst.
Wir kommen im Vertrauen zu Ihnen.,
in dem Wissen, dass du niemanden zurückweist.
Du bist die Auferstehung und das Leben.
Wenn unsere Herzen zweifeln, erinnere uns an dein Versprechen.
Wenn uns die Angst gefangen hält, befreie uns durch den Glauben.
Gewähre deiner Kirche die Gnade, dieses Geheimnis mit Freude zu verkünden.,
und dass jeder von uns von nun an im Lichte des Jüngsten Tages lebt.
Gedenkt der Verstorbenen.
Mögen sie in Frieden ruhen.,
und dass wir eines Tages in deinem Reich versammelt werden mögen.
Amen.

Abschluss
An den Sohn zu glauben bedeutet, schon heute an der Bewegung der Auferstehung teilzuhaben. Diese Stelle aus dem Johannesevangelium lehrt uns, dass Gottes Treue stärker ist als unsere Ängste. Das ewige Leben beginnt nicht morgen, sondern entfaltet sich bereits in der empfangenen und weitergegebenen Liebe.
Jeder Akt des Vertrauens, jeder hoffnungsvolle Blick, jedes tägliche Opfer wird zur Teilhabe am Sieg Christi.
Dieses Versprechen anzunehmen, verändert unser Leben, unsere Trauer und unsere Liebe. Möge uns dieses Wort durch Tage des Lichts und der Nacht begleiten: Der Sohn wird uns am Jüngsten Tag auferwecken.
Praktisch
- Lies eine Woche lang jeden Morgen Johannes 6,37-40.
- Suchen Sie nach einem Ort oder einer Beziehung, in der Sie neues Vertrauen aufbauen können.
- Jede erlebte Schwierigkeit mit der Verheißung des Jüngsten Tages zu verbinden.
- An einer Messe teilnehmen, indem man eine Intention für den Verstorbenen äußert.
- Zum Nachdenken über das Wort «Willkommen»: Was bedeutet es für mich?
- Führe ein Hoffnungstagebuch, um die empfangenen Lebenszeichen festzuhalten.
- Schließe jedes Gebet mit «Und ich werde ihn von den Toten auferwecken» ab.»
Verweise
- Evangelium nach Johannes, Kapitel 6 und 11.
- Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 988-1019.
- Heiliger Augustinus, Predigten zum Johannesevangelium.
- Irenäus von Lyon, Gegen Häresien, V, 36.
- Papst Franziskus, Christus Vivit, 2019.
- Allerheiligenliturgie und christliche Beerdigungen.
- Benedikt XVI., Spe Salvi, 2007.
- Der heilige Gregor von Nyssa, Über das gesegnete Leben.



