Evangelium Jesu Christi nach Lukas
Damals,
Große Menschenmengen begleiteten Jesus;
Er drehte sich um und sagte zu ihnen:
«"Wenn jemand zu mir kommt
ohne mich seinem Vater, seiner Mutter, seiner Frau vorzuziehen,
seine Kinder, seine Brüder und Schwestern,
und sogar sein eigenes Leben,
Er kann nicht mein Jünger sein.
Wer sein Kreuz nicht trägt
in meinem Kielwasser zu wandeln
Er kann nicht mein Jünger sein.
Welcher von euch?
der einen Turm bauen möchte,
Fang nicht damit an, dich hinzusetzen
um die Kosten zu berechnen
Und sehen wir, ob er das Zeug dazu hat, es bis ganz nach oben zu schaffen?
Denn falls er jemals die Grundlagen legt
und kann den Vorgang nicht abschließen,
Jeder, der ihn sieht, wird ihn auslachen:
“Hier ist ein Mann, der begonnen hat, etwas aufzubauen.“
und konnte es nicht beenden!”
Und wer ist der König?
der gegen einen anderen König in den Krieg zog,
Fang nicht damit an, dich hinzusetzen
um zu sehen, ob er es mit zehntausend Mann kann.,
Um demjenigen, der mit zwanzigtausend Menschen gegen ihn marschiert, entgegenzutreten?
Wenn er das nicht kann,
Er schickt es ab, während der andere noch weit entfernt ist.,
eine Delegation, die Bedingungen für den Frieden fordern soll.
Wer also unter euch nicht abschwört
alles, was ihm gehört
Er kann nicht mein Jünger sein.»
– Lasst uns das Wort Gottes bejubeln.
Aufgeben, um zu folgen: Das eigene Leben auf evangelikaler Enteignung aufbauen
Warum Jesu Forderung nach innerer Loslösung einen Weg zu wahrer Freiheit und innerer Fruchtbarkeit eröffnet.
Diese Lesung aus dem Lukasevangelium (14,25–33) richtet sich an alle, die nach einem Einklang zwischen Glauben und Alltag suchen, zwischen der radikalen Kraft von Jesu Worten und der Zärtlichkeit seines Rufes. Ein Jünger Christi zu sein bedeutet, einer inneren Wandlung zuzustimmen: nichts ihm vorzuziehen, selbst wenn dies die Überprüfung unserer Beziehungen, unseres Besitzes und unserer Pläne erfordert. Diese Forderung ist keineswegs eine Ablehnung der Welt, sondern offenbart eine Dynamik der Liebe, die frei von Besitzgier ist. Dieser Artikel schlägt einen schrittweisen Zugang vor, um diese Entsagung als Quelle der Freude zu verstehen, anzunehmen und zu leben.
- Evangeliumskontext und Umfang der Passage
- Analyse der dreifachen Anforderung an den Jünger
- Drei Schlüsselbereiche zum Verständnis des evangelikalen Verzichts
- Praktische Anwendungen im Alltag
- Schriftliche und spirituelle Resonanzen
- Meditation und praktische Anwendungsübungen
- Zeitgenössische Herausforderungen und ein Perspektivenwechsel
- Gebet des Vertrauens und der Hingabe
- Fazit und einfache Verpflichtungen
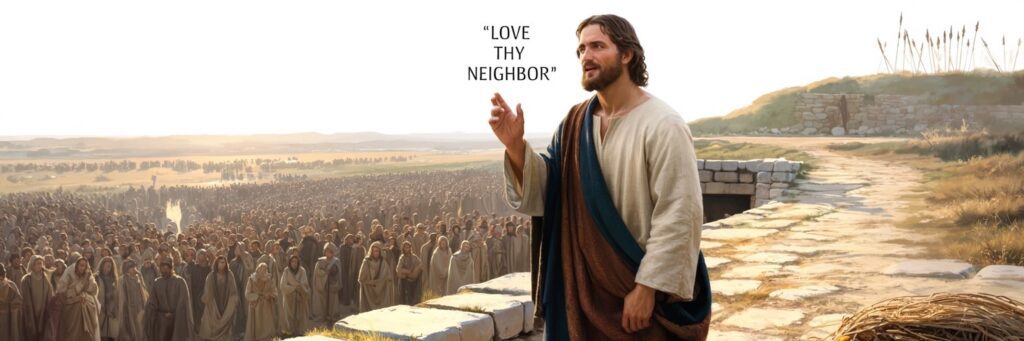
Der Schock des Verzichts: Worte wieder in ihren Kontext einordnen
Das Lukasevangelium schildert Jesus oft auf einer Reise. Die Szenerie in Kapitel 14 ist bezeichnend: Menschenmengen folgen Jesus, gebannt von seinen Worten und Zeichen. Doch anstatt oberflächliche Begeisterung zu fördern, konfrontiert er sie mit der Wahrheit des Weges. Jünger zu sein bedeutet nicht, ihn zu bewundern, sondern ihm bis zum Ende zu folgen. Der Ton ist abrupt: «Wenn jemand zu mir kommt und seinen Vater und seine Mutter nicht hasst … kann er nicht mein Jünger sein.» Diese Worte sind befremdlich, besonders in einer Kultur, die an Familie, Blutsbanden und materieller Sicherheit hängt.
Diese logische Umkehrung verdeutlicht die immense Tragweite: Jesus wünscht sich keine oberflächliche Loyalität, sondern ein offenes Herz. Die beiden folgenden Gleichnisse – das vom Baumeister und das vom König – zeigen, wie wichtig es ist, vor einer Entscheidung die richtige Entscheidung zu treffen. Christsein ist kein Gefühl, sondern ein Prozess, der ein solides Fundament braucht. Der Jünger ist es, der die Konsequenzen abwägt, nicht aus Ängstlichkeit, sondern aus liebevoller Klarheit: Er versteht, dass Christus nachzufolgen bedeutet, alles hinzugeben.
In der biblischen Kultur ist Verzicht nicht gleichzusetzen mit Verachtung. Vielmehr geht es um Ordnung: darum, jeder Bindung ihren angemessenen Platz einzuräumen. Die radikale Natur des Evangeliums zerstört nicht die menschliche Liebe, sondern erhellt sie. Christus fordert uns nicht auf, unsere Lieben zu verlassen, sondern sie nicht länger zu besitzen. Er verlangt nicht, dass wir unseren Besitz verachten, sondern dass wir ihn beherrschen, um ihn zum Wohle aller einzusetzen.
Lukas wendet sich an eine Gemeinde, die bereits mit den Spannungen der Wahl konfrontiert ist: Wie kann man angesichts der jüdischen Familie, die den neuen Glauben ablehnt, und angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Zwänge des Römischen Reiches treu bleiben? Diese Passage lädt uns daher ein, Treue neu zu definieren als eine Verschiebung des Schwerpunktes: nicht mehr man selbst, sondern Christus.
Ein Jünger in wahrer Weise sein: die Bilder Jesu verstehen
Jesus verwendet zwei alltägliche Bilder – den Bau eines Turms und den Krieg –, um den Zusammenhang zwischen Absicht und Dauer zu verdeutlichen. Der unbesonnene Baumeister symbolisiert den enthusiastischen, aber unbeständigen Gläubigen; er legt ein Fundament, ohne die Folgen zu bedenken. Der unvorbereitete König steht für denjenigen, der sich auf das geistliche Leben einlässt, ohne seine wahre Stärke zu erkennen. Diese Gleichnisse entlarven die Illusion eines oberflächlichen Glaubens.
Doch diese Passage geht noch weiter: Sie vereint Unterscheidungsvermögen und Verzicht. Wahre Armut wird nicht ertragen, sondern bewusst gewählt. Jesus fordert uns auf, «unser Kreuz auf uns zu nehmen», ein typischer Ausdruck bei Lukas, der Treue selbst im Leid symbolisiert. Das Kreuz ist hier nicht bloß ein Instrument des Todes, sondern ein Lebensweg: Verlust zu akzeptieren, um umso mehr lieben zu können.
Um diese radikale Nüchternheit zu verstehen, muss sie mit den Lehren der Weisheit in Verbindung gebracht werden. In der Bibel ist Verzicht ein innerer Exodus: das Zurücklassen von Illusionen, um in die Wahrheit einzutreten. Wie Abraham, der sein Land verließ, gibt der Jünger die Sicherheit von Besitz, Anerkennung und Kontrolle auf. Christus ruft zu einer lebensspendenden Beziehung auf, in der Abhängigkeit zu Freiheit wird, weil sie nicht auf Angst, sondern auf Vertrauen gründet.
Die Passage gipfelt in dieser prägnanten Aussage: «Wer nicht auf alles verzichtet, was ihm gehört, kann nicht mein Jünger sein.» Diese absolute Formel schließt nicht aus, sie leitet. Sie definiert Besitz neu: Was mir gehört, ist mir gegeben, um zu dienen. Wahre Loslösung ist innerlich: Sie befreit die Liebe von jeder Kontrolle.
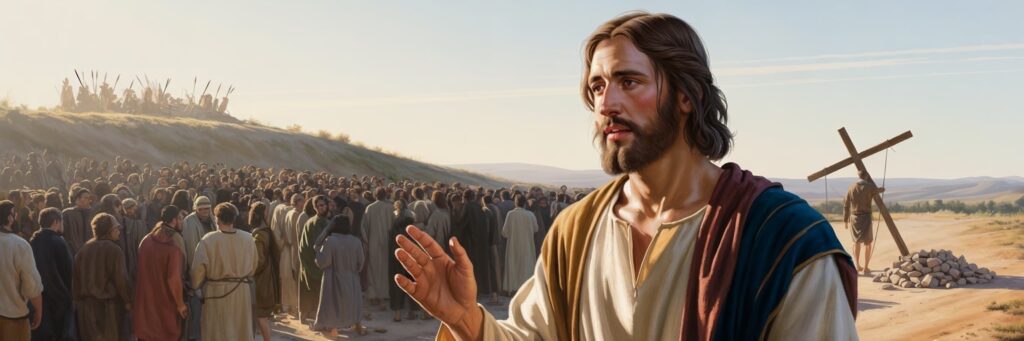
Verzicht, eine Schule der Freiheit
Verzicht bedeutet Befreiung. In einer Gesellschaft, die vom Besitz – von Gütern, Bildern, Status – besessen ist, schlägt das Evangelium einen anderen Lebensweg vor: Empfangen statt besitzen, teilen statt anhäufen. Diese Loslösung zerstört nicht die Persönlichkeit; sie offenbart das Wesentliche.
Christliche Freiheit besteht nicht darin, alles tun zu können, sondern darin, von nichts mehr abhängig zu sein. Durch Verzicht erfährt der Jünger eine Leichtigkeit des Herzens. Die Welt verspricht Sicherheit durch Kontrolle; Jesus bietet Frieden durch Vertrauen. Doch Vertrauen erfordert Loslassen. Der Weg des Jüngers wird so zu einer Schule des schrittweisen Ablegens: falsche Sicherheiten aufgeben, um in der Treue Christi verwurzelt zu werden.
Urteilsvermögen, die Architektur des Verzichts
Jesus ermutigt nicht zu spiritueller Improvisation. «Sich hinzusetzen und die Kosten abzuwägen» beschreibt die Weisheit des Herzens. Dies bedeutet, die eigenen Grenzen zu erkennen und keine leichtfertigen Verpflichtungen einzugehen. Unterscheidungsvermögen ist kein Hindernis, sondern die Voraussetzung für Treue.
Viele Menschen beginnen ihr geistliches Leben, ohne sich selbst geerdet zu haben. Sie wollen Gott lieben, ohne sich selbst zu kennen. Doch Unterscheidungsvermögen bedeutet, zu erkennen, was in uns dem Geist Christi widersteht: Stolz, Anhaftung, Angst. Die Auseinandersetzung mit dem Evangelium ist keine Abrechnung, sondern eine innere Prüfung: Bin ich bereit, Gott mein Fundament neu aufbauen zu lassen? Wahre Bekehrung geschieht dort.
Bevorzugte Liebe, die Grundlage der Loslösung
«Christus über alles andere zu stellen bedeutet, der Liebe ihren rechtmäßigen Platz zurückzugeben. Wer Gott zuerst liebt, lernt, seine Mitmenschen tiefer zu lieben. Evangelikale Loslösung ist keine Trennung, sondern eine Prioritätensetzung.
In diesem Licht betrachtet, wird jedes menschliche Streben geheiligt: Familie, Arbeit, Schöpfung, materieller Besitz. Indem wir sie als Gaben und nicht als Rechte annehmen, entdecken wir Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit macht Armut zu einer Freude: Sie ist kein Mangel, sondern ein Geschenk.

Verzicht im Alltag verkörpern
Diesen Wandel heute zu erleben bedeutet, unsere innere Logik zu verändern. Im persönlichen Bereich ist der Lernende eingeladen, seine Wünsche zu läutern: zu lernen, Ablenkungen abzulehnen und der Tiefe zuzustimmen. Im Beziehungsbereich bedeutet es, frei zu lieben, ohne nach Dominanz oder Unentbehrlichkeit zu streben. Im beruflichen Bereich drückt sich dies durch bescheidene Ambitionen und die Priorisierung von Gerechtigkeit gegenüber Erfolg aus.
Auf Gemeindeebene kann dies zu konkreten Entscheidungen führen: das Gemeinwohl über persönliche Anerkennung stellen, ein Leben in freiwilliger Einfachheit führen und Bedürftige unterstützen. Innerhalb der Kirche bedeutet es, nicht persönlichen Vorlieben, sondern der Mission zu folgen. Schließlich bedeutet Verzicht auf innerer Ebene, Schwächen anzunehmen und Gott das anzuvertrauen, was außerhalb unserer Kontrolle liegt.
Jeder Akt des Verzichts wird somit zu einem Akt des Glaubens. Wir verlieren nicht, wir schaffen Raum, in dem Gott wirken kann.
Die spirituellen und theologischen Resonanzen des Verzichts
Dieses Lukas-Zitat wurzelt in der gesamten biblischen Tradition der Loslösung. In der Genesis verlässt Abraham sein Land; in den Psalmen setzen die Gerechten ihr Vertrauen nicht auf Reichtümer; in den Evangelien lassen die Apostel ihre Netze und Boote zurück.
Die Theologie der Entsagung gründet sich auf das Ostergeheimnis: das Sterben des eigenen Selbst, um in Gott zu leben. Der heilige Paulus drückt es so aus: «Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.» Entsagung ist daher keine Demütigung, sondern eine ontologische Wandlung.
In der klösterlichen Tradition wird diese Haltung zu einem Weg zur Freiheit: Der heilige Benedikt spricht davon, «alles aufzugeben, um alles zu gewinnen». Ignatius von Loyola formuliert die Losgelöstheit als «heilige Gleichgültigkeit», das heißt als totale innere Bereitschaft.
Auf spiritueller Ebene öffnet der Verzicht den Weg zur Gnade der inneren Armut: Wenn die Seele aufhört, nach Besitz zu streben, kann sie endlich empfangen. Diese Haltung ist das Fundament sowohl des kontemplativen Lebens als auch der aktiven Mission.
Meditation: In seinen Fußstapfen wandeln
Schritt 1. Lesen Sie die Passage langsam erneut und nehmen Sie die Worte unvoreingenommen auf.
Schritt 2. Identifizieren Sie, was heute den Mittelpunkt Ihres Herzens einnimmt: Anhaftung, Angst, Besitzgier.
Schritt 3. Bitte um die Gnade, Christus den Vorzug zu geben, nicht durch Heldentum, sondern durch Liebe.
Schritt 4. Konkret handeln: teilen, vergeben, vereinfachen.
Schritt 5. Vertraue jeden Abend Gott an, was du allein nicht ertragen kannst.
So wird die Meditation zu einem Ort der inneren Vereinigung, wo die Forderungen Christi in empfangene Sanftmut umgewandelt werden.
Aktuelle Herausforderungen: Aufgeben in einer gesättigten Welt
Unsere Gesellschaften legen Wert auf Autonomie und Leistung. Von Verzicht zu sprechen, erscheint anachronistisch. Doch die Exzesse des Konsumismus zeigen deutlich, wie dringend wir Freiheit neu definieren müssen.
Die erste Herausforderung ist psychologischer Natur: die Angst vor Mangel. Etwas aufzugeben, widerspricht unserem Sicherheitsbedürfnis. Doch die Antwort des Evangeliums ist nicht Schuldgefühl, sondern Vertrauen. Die zweite Herausforderung ist sozialer Natur: Materieller Erfolg verführt selbst Gläubige. Nüchternheit wird zum Widerspruch zur Gesellschaft. Schließlich ist die spirituelle Herausforderung der Individualismus: die Vorstellung, man könne Christus ohne Gemeinschaft nachfolgen.
Angesichts dessen besteht die christliche Haltung darin, Unterscheidungsvermögen und Mut zu vereinen: die Bindungen zu erkennen, die uns gefangen halten, und den Mut zu haben, uns nach und nach von ihnen zu befreien. Evangelischer Verzicht ist nicht spektakulär: Er wird in der Stille des Herzens gelebt.
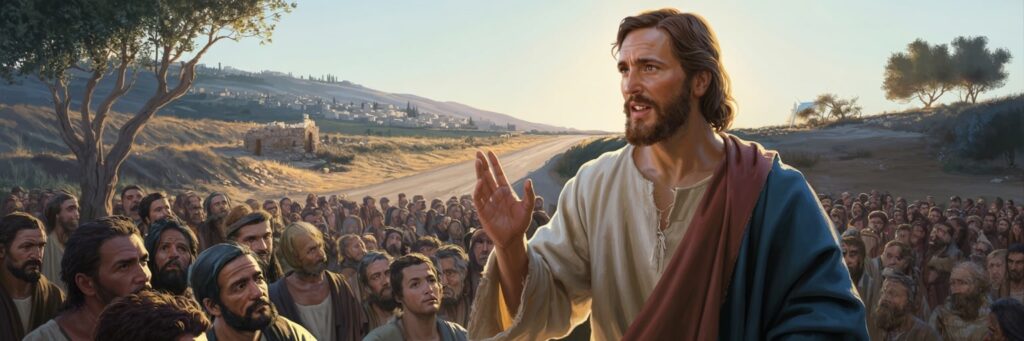
Gebet der Hingabe und des Friedens
Herr Jesus,
Ihr, die ihr direkt zum Kreuz gegangen seid,
Lehre mich, in deine Fußstapfen zu treten.
Lehre mich, deine Liebe meinen Wertpapieren vorzuziehen.,
um meine Besitztümer in Ihre Hände zu geben.
Wenn mich die Angst zurückhält, erinnere mich an dein Wort:
Wer sein Leben für dich verliert, wird es retten.
Löse meine Fesseln des Stolzes und des Besitzes.,
Gib mir den Frieden eines freien Herzens.
Möge mein Leben ein Akt der Dankbarkeit werden.,
Meine Armut, ein Raum für deine Gnade.,
und meine Verzichte ein Lied des Vertrauens.
Dass ich dir nicht unter Zwang folge,
sondern durch dankbare Liebe, zu unendlicher Freude.
Fazit: Die Freude am Ausziehen wiederentdecken
Christlicher Verzicht ist keine Verstümmelung, sondern eine Öffnung. Er verarmt nicht, sondern bereichert. Er befreit die Menschheit von Illusionen und formt sie nach Christus. In einer Welt, die ständig «immer mehr» verspricht, verkündet das Evangelium: «Weniger ist mehr, mit Liebe.».
Ein Jünger zu sein bedeutet, zu lernen, aufzubauen, ohne zu besitzen, zu lieben, ohne festzuhalten. Darin liegt der wahre Friede: der Friede des Vertrauens in Gott.
Praktiken
- Beginne jeden Tag mit einem einfachen Opfer: «Herr, was auch immer geschieht, ich gehöre dir.»
- Sich für konkrete Einfachheit entscheiden: auf einen unnötigen Kauf, ein bestimmendes Wort oder eine Beschwerde verzichten.
- Einen symbolischen Besitz (Gegenstand, Gewohnheit, Zeit) einem Kunstwerk oder einem geliebten Menschen zu widmen.
- Übe dich wöchentlich in Unterscheidung: Was bindet mich? Was befreit mich?
- Lies vor dem Schlafengehen eine Passage aus den Psalmen über Vertrauen und meditiere darüber.
- Sei jeden Tag dankbar für das, was dir gegeben wird, ohne Vergleiche anzustellen.
- Beteilige dich an einer Solidaritäts- oder Hilfsinitiative.
Verweise
- Evangelium nach Lukas 14,25-33
- Erster Brief des Petrus 4:14
- Regel des heiligen Benedikt, Kap. 4
- Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, Nr. 23
- Thérèse von Lisieux, Letzte Gespräche
- Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Band I
- Franziskus, Ermahnung Evangelii Gaudium
- Katechismus der Katholischen Kirche, §2544-2547


